OSKAR LAFONTAINE - DER POPULIST FÜR ALLES
Lafontaine im O-Ton
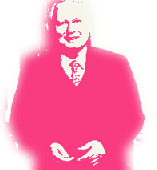 Lafontaine noch 1990 über Gysi und die PDS (Quelle: Politiker schimpfen über Politiker, Reclam1998): "Ich frage mich, wie lange die Erbschleicher des Stalinismus, die Herren Gysi, Kohl und Lambsdorff, noch warten wollen, bis sie das unrechtmäßig erworbene Parteivermögen auf Heller und Pfennig an das Volk zurückgeben."
Lafontaine noch 1990 über Gysi und die PDS (Quelle: Politiker schimpfen über Politiker, Reclam1998): "Ich frage mich, wie lange die Erbschleicher des Stalinismus, die Herren Gysi, Kohl und Lambsdorff, noch warten wollen, bis sie das unrechtmäßig erworbene Parteivermögen auf Heller und Pfennig an das Volk zurückgeben."
Im Original: Zusammenstellung aus der FAU Leipzig
[Lafontaine zu den 'Sozialreformen']
"Wenn diese Politik zu Wachstum führt, bin ich der Erste, der das anerkennt. Aber wo ist das Wachstum?" Wenn es in den letzten Jahren Wachstum gegeben habe, dann sei es "von der Weltkonjunktur gekommen, von der aktiven Wirtschaftspolitik der anderen". (Quelle)
[Gegen die systematische Verarmung vieler Menschen hat er also nichts, solange es nur Wachstum bringt]
[Arbeitszwang:]
So war er [Lafontaine] der erste SPD-Oberbürgermeister, der bereits vor 20 Jahren in Saarbrücken Zwangsarbeit für jugendliche Sozialhilfeempfänger einführte. Als Ministerpräsident des Saarlandes versuchte er später seine Kritiker durch die gesetzliche Einschränkung der Pressefreiheit mundtot zu machen. Unvergessen ist auch, wie er 1993 in der SPD die Zustimmung zur Abschaffung des Asylrechts durchsetzte. Jetzt aber erklärt er die Schaffung eines starken Staates explizit zur Achse seiner Innenpolitik. (Quelle)
[offizioesere Quelle dazu, allerdings sehr beschoenigend:]
Initiator des "Saarbrücker Programmes zur Bekämpfung der Berufsnot junger Menschen" im Jahr 1983 war der damalige Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken Oskar Lafontaine. [...] Aufgaben des Amtes für kommunale Arbeitsmarktpolitik sind die konzeptionelle Planung und Koordinierung von Maßnahmen zur Ausbildungs- und Berufsvorbereitung, der beruflichen Bildung und schließlich in Abstimmung mit beteiligten Fachämtern die Beschäftigung im Rahmen des Saarbrücker Programmes.
Hierbei werden verschiedene rechtliche Möglichkeiten miteinander verknüpft, unterschiedliche Finanzierungsquellen gebündelt und verschiedene Maßnahmearten miteinander verzahnt. (Quelle)
Bereits früher als andere - selbst konservative Politiker - hat Lafontaine die Forderungen nach flexibleren Arbeitszeiten, längeren Maschinenlaufzeiten, Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich und vieles mehr aufgestellt. Im Wahlprogramm der SPD von 1998 - das unter seiner Leitung ausgearbeitet wurde - nahm die Forderung nach einem staatlich geförderten Niedriglohnsektor, in dem Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose zur Arbeitsaufnahme gezwungen werden, großen Raum ein. Und er war es, der als Finanzminister den Vorschlag machte, Arbeitslosenunterstützung nur noch an Bedürftige auszuzahlen, was damals noch mehrheitlich in der SPD abgelehnt wurde.
Auch heute wendet sich Lafontaine nicht gegen den Abbau der bestehenden Sozialsysteme. Ihm geht es um die soziale Akzeptanz der Kürzungen. Nur wenn die Regierung - zumindest dem Schein nach - auch die Reichen und Großverdiener zur Kasse bittet und nicht für jeden sichtbar als Büttel der Wirtschaftsverbände fungiert, können der Bevölkerung die sozialen Lasten aufgebürdet werden, lautet seine Devise. (Quelle)
[Aus eben diesem SPD-Programm:]
Im Zusammenhang mit diesen positiven Anreizen werden wir dafür sorgen, daß Sozialhilfeempfänger angebotene Arbeitsplätze auch annehmen. Sollten angebotene Arbeitsplätze ohne wichtigen Grund nicht angenommen werden, so müssen die bestehenden gesetzlichen Vorschriften zur Kürzung der Sozialhilfe angewandt werden. In einer Gemeinschaft gibt es nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. (SPD Wahlprogramm 1998)
Die neue rotgrüne Regierung ist mit dem Slogan "Arbeit, Arbeit, Arbeit" an die Macht gekommen und hat schnell weitreichende Veränderungen am Sozialstaat angekündigt: Lafontaine überlegte z.B. laut, ob nicht auch das ArbeitslosenGELD in Zukunft an eine tatsächliche Bedürftigkeit zu binden sei, eine Vorstellung, gegen die sich der Blüm-Flügel innerhalb von CDU und alter Regierung jahrelang erfolgreich gewehrt hatte. Ein Teil des "Bündnisses für Arbeit" (und "Wettbewerbsfähigkeit", wie die Sozialdemokratie ehrlicherweise dem alten Titel hinzugefügt hat) sind neue Programme, um Arbeitslose zwangsweise in Jobs oder Maßnahmen zu drücken. Kurz nach Regierungsantritt wurde ein Sofortprogramm verkündet, das 100.000 Jugendliche in Arbeit oder Ausbildung bringen soll. Lohnkostenzuschüsse an die Unternehmer sind selbstverständlich enthalten. Dieser Plan wird offen als Drohung unter die Leute gebracht: "Falls ein Jugendlicher innerhalb des Programms ein zumutbares Angebot vom Arbeitsamt ablehne, müsse er mit Konsequenzen bei der weiteren Unterstützung rechnen, betonte (Bundesarbeitsminister) Riester. Die vorhandenen Gesetze erlaubten durchaus diesen Zwang." (Süddeutsche Zeitung vom 16.1.99) Gerade den Jugendlichen soll also von Anfang an klargemacht werden, daß es kein Leben ohne Arbeit geben kann. Das ist die Linie aller sozialdemokratischen Regierungen, die in den letzten Jahren in Europa wieder an die Macht gekommen sind: ob Labour in England oder Sozialisten in Frankreich, ihre ersten Maßnahmen bestanden darin, Druck auf die arbeitslosen Jugendlichen auszuüben, einen Job anzunehmen. Niemand soll länger als ein halbes Jahr ungestört von Sozialleistungen leben können, das ist ihre Devise. (Quelle)
Der Staat muß [...] die Verantwortung dafür übernehmen, daß jeder Bürger sein Recht auf Arbeit einlösen kann. Dann muß dem Staat aber auch zugestanden werden, diejenigen Bürger zur Arbeit zu verpflichten, die zwar von der Gesellschaft leben, ihr aber ihre Leistung verweigern wollen. Die Pflicht zur Arbeit kann nur einfordern, wer vorher Arbeit angeboten hat. (Lafontaine/Müller, Spiegel, 9.3.1998 ++ Quelle)
[Staatsfetischismus:]
Unter der Überschrift "Wie geht's nach den Terror-Anschlägen weiter?" machte er zunächst deutlich, dass er bezüglich der außenpolitischen und militärischen Reaktion mit der Berliner Rot-Grünen Koalition keine Differenzen hat.
Dann schreibt er: "Wir lernen wieder: Macht und Ohnmacht gehen Hand in Hand. Offene Gesellschaften brauchen einen starken Staat. Deregulierung, Privatisierung, Green Card für Techniker, Pilotenscheine für ein paar Dollar, Niederlassungsfreiheit für jedermann und leere Staatskassen untergraben innere und äußere Sicherheit. Die Verächtlichmachung des Staates muss ein Ende haben. Der Staat sind wir!" (Quelle)
[Ruf nach Volksgemeinschaft:]
"Wer in Deutschland keine Steuern zahle, solle auch die Staatsbürgerschaft verlieren, "der ist dann kein Deutscher mehr, der gehört dann auch zu unserer Solidargemeinschaft nicht mehr, so Lafontaine im n-tv." (Quelle)
[Sexismus/Antifeminismus:]
Womit verhüten Emanzen - mit dem Gesicht. (Quelle]
[instrumentelle Herrschaft/ Promiorientierung]
"Lafontaine steht unseren Positionen nah, insofern ist er unser Partner", erläutert Thomas Rudolph von der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG) diese Entscheidung im Gespräch mit junge Welt. Man wolle eine Demonstration "von bundesweiter Bedeutung" auf die Beine stellen, erklärte Rudolph. Das sei allein mit der Einladung des Saarländers bereits geglückt. (Quelle)
[noch peinlicher allerdings der DGB:]
"Der Leipziger DGB-Vorsitzende Bernd Günther wollte die beteiligten Gruppen am Mittwoch abend zusammenholen, um einen Konsens zu erzielen. Sein Vorschlag: "Die Politiker, die das eingebrockt haben, zum Beispiel Clement oder Stolpe, sollten sich vor den Menschen äußern" Lafontaine könne gegebenenfalls im Anschluß daran sprechen, so Günther auf jW-Nachfrage. Für Rudolph ist hingegen "klar, daß nur Politiker sprechen sollen, die die Ziele der Demonstranten auch unterstützen". Für Lafontaine gelte dies, betonte er." (Quelle)
"Stefan Brangs von ver.di Sachsen meinte, er hoffe, "daß diese Demonstration nicht zu einer Lafontaine-Demo mutiert". Brangs betont die "gesellschaftliche Verantwortung" des Bündnisses. Was das heißt? Man dürfe nicht die "falsche Hoffnung wecken, daß man Hartz IV noch verhindern kann". Maximal seien "weitere Nachbesserungen für den Osten" zu erreichen. (Quelle)
Weitere gesammelte Zitate

Lafontaine in seiner Rede auf der Montagsdemo am 30.8.2004 in Leipzig (dokumentiert in Junge Welt, 1.9.2004, S. 10)
Es ist für mich eine Ehre, hier in Leipzig zu sprechen. In der jüngeren deutschen Geschichte steht Ihre Stadt für den Ruf nach Freiheit und Demokratie. "Wir sind das Volk" ist nicht nur ein Protest gegen die einstige Parteiendiktatur der SED. Er ist genauso angebracht, wenn über die Köpfe des Volkes hinweg Sozialreformen nach dem Motto beschlossen werden, doe Oberen werden entlastet und die Unteren werden immer stärker belastet, dann müßt ihr sagen: Wir sind das Volk. ...
Laßt uns mehr Demokratie wagen, laßt uns mehr soziale Demokratie wagen. Übersetzt heißt das, die Interessen des Volkes müssen dominieren, nicht die Interessen einer Minderheit.
Skandinavischer Kapitalismus besser (wie bei Attac, siehe vor allem Positionen Sven Giegolds ...)
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine andere Politik ist möglich, das zeigen die Beispiele anderer Staaten ... Ich weise insbesondere auf die Praxis in den nordischen Staaten.
Mehr Wachstum! Das bringt mehr Arbeit!
Aus Oskar Lafontaine (2005): "Politik für alle", Berlin (S. 290, zitiert nach Sozialismus 4/2005, S. 7)
Der Neoliberalismus hat über viele Jahre ein ausreichendes Wachstum unserer Wirtschaft und damit einen Abbau der Arbeitslosigkeit verhindert.
Starke Gesetze helfen den Schwachen (wer aber macht diese Gesetze???)
Lafontaines Rede auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz 2006 - peinlich gehypt und bejubelt von verschiedenen Seiten, abgedruckt in der Jungen Welt,19.1.2006 (S. 10., Teil 1) und 20.1.2006 (S. 10, Teil 2), Auszüge:
Wir wollen nicht Deregulierung, sondern wir wollen Regulierung. ... Zwischen dem Starken und dem Schwachen befreit das Gesetz, während die Freiheit unterdrückt. Ich wiederhole diesen historischen Satz Rousseaus noch einmal, weil er wirklich eine Handlungsanleitung ist für vieles, was wir in Zukunft zu tun haben: Zwischen dem Starken und dem Schwachen befreit das Gesetz. Der Schwache braucht das Gesetz, um überhaupt in Freiheit leben zu können, um sich überhaupt gegenüber dem Stärkeren behaupten zu können, während die Freiheit unterdrückt, weil dann der Stärkere sich durchsetzt und die Schwächeren an die Wand drückt. Und wenn man sich die Weltpolitik einmal ansieht, und wenn man unsere Sozialgesetzgebung, den Kündigungsschutz und so weiter betrachtet – immer wieder stoßen wir auf dasselbe Prinzip: der Abbau von Regeln, der Abbau von Gesetzen nützt dem Stärkeren und schwächt die Schwächeren – also müssen wir das umgekehrt handhaben. ...
Wenn wir also den Rousseauschen Gedanken aufgreifen und ihn als verbindliche Handlungsmaxime für die Linke definieren, dann heißt das in der Außenpolitik zunächst einmal, strengstens auf das Völkerrecht zu achten und für das Völkerrecht einzutreten. Wenn die Staaten des Westens dies beherzigen würden, sähe die gesamte Außen- und Weltpolitik völlig anders aus. Die Beachtung des Völkerrechts ist dringende Voraussetzung für jede Form linker Außenpolitik.
Rhetoriker Lafontaine: Eigentlich gegen Privatisierung, außer man tut es?
Aus einem Interview in der FR, 3.3.2006 (S. 5)
In der Wohnungswirtschaft in Berlin haben wir eine Sondersituation. Keine andere Stadt hat einen so hohen Anteil von öffentlichen Wohnungen. Insofern konnte die Regierung zu dem Ergebnis kommen, zur Haushaltssanierung ein Wohnungsunternehmen zu veräußern.
Aus einem Interview mit dem Spiegel am 14.3.2006 (auch auf den Seiten der Linkspartei selbst hervorgehoben - wird also offenbar geteilt)
Die Linke spricht die Sprache des Volkes. ...
Frage: Ärgern Sie sich, wenn man Sie einen Populisten nennt?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt genug dröge Leute, die das Volk langweilen. ... Auch der alte Lafontaine hat in Wahlkämpfen immer sehr volksnah gesprochen. ... Freiheit heißt richtig verstanden auch, dass nicht die Wirtschaft herrscht, sondern das Volk. Dagegen haben wir in einer neoliberalen Welt, in der 500 Konzerne die Hälfte des Weltsozialprodukts steuern und Regierende nur noch zu Marionetten werden, einen Verlust der Demokratie. ...
Für Staat, Recht und Demokratie, gegen US-Konzerne
Aus der Rede beim Fusionsparteitag DIE LINKE am 16.6.2007, dokumentiert in: Junge Welt, 18.6.2007 (S. 10 f.)
Wir, liebe Freundinnen und Freunde, sind die Partei der demokratischen Erneuerung. Demokratie – so sagte der große griechische Staatsmann Perikles – ist eine politische Ordnung, in der die Angelegenheiten im Interesse der Mehrheit entschieden werden. ...
Wir sind die neue Kraft, die in die deutsche Außenpolitik das Völkerrecht wieder einführen will. ... wie im Inneren der Staaten nur das Recht den Frieden herstellt, so kann zwischen den Staaten nur das Völkerrecht den Frieden herstellen. ... Demokratie setzt auch die Beachtung des Rechts und die Beachtung des Rechtsstaates voraus! ...
Denn wir haben mehr Demokratie, wenn die Staaten und Gesellschaften darüber entscheiden, was mit ihren Reichtümern geschieht. als wenn amerikanische Großkonzerne alles regeln und die Profite abkassieren.
1988 ...
Lafontaine ist stellvertretender Parteivorsitzender der SPD-Bundespartei, Ministerpräsident im Saarland. Wenig später beginnen die Beben, die zur deutschen (territorialen) Einheit führen und Lafontaine kritisiert die Nationenbildung. Im Jahr 1990 wird er Kanzlerkandidat der SPD und verliert gegen den Einheitskanzler Kohl.Von Lafontaine erscheint das Buch "Die Gesellschaft der Zukunft". Auszüge:
Im Original: Auszüge aus Lafontaines Buch als SPD-Boss
Verzicht auf Nationalstaatlichkeit
Inzwischen aber hat sich die deutsche Nation so sehr verspätet, daß sie in ihrem Streben nach Staatlichkeit unzeitgemäß geworden ist. Was macht es noch für einen Sinn, auf lange Sicht nach nationalstaatlicher Einheit zu streben, wo doch schon auf kurze Sicht die politische Idee des Nationalstaats durch die Transnationalität der Probleme faktisch außer Kraft gesetzt wird? Der Nationalstaat hat schon heute die Vernünftigkeit seiner Idee überlebt. Sollten wir nicht endlich aufhören, dieses unter dem Aspekt der Vernunft anachronistische Dasein durch rückwärtsgewandte Utopien auch noch zu verlängern?
Gerade weil uns Deutschen die Vorstellung der nationalstaatlichen Einheit versagt blieb und auf absehbare Zeiten versa-t bleiben wird, gerade weil wir Deutschen mit einem pervertierten Nationalismus schrecklichste Erfahrungen gemacht haben, gerade deshalb sollte uns schlechthin der Verzicht auf Nationalstaatlichkeit leichter fallen als anderen Nationen, die mit der Entstehung ihres Nationalstaats auch die Entfaltung einer demokratischen Gesellschaftsordnung verbinden konnten und immer noch können. Aufgrund der jüngsten Geschichte sind die Deutschen geradezu prädestiniert, die treibende Rolle in dem Prozeß der supranationalen Vereinigung Europas zu übernehmen. Statt dessen erleben wir im Lager des Neokonservatismus eine Art Renaissance der nationalstaatlichen Idee, eine Art verzweifelter Suche nach den besseren, schöneren Wurzeln der deutschen Nation in der deutschen Geschichte, die einer politischen Realitätsflucht gleichkommt. Man merkt es den Neokonservativen an, wie schwer es ihnen fällt, sich einzugestehen, daß die Bundesrepublik Deutschland ihre Wurzeln auch in Auschwitz hat. Dies zu vergessen oder zu verdrängen, wäre so amoralisch wie gefährlich. Denn reichte unsere bundesdeutsche Nationalidentität nicht mehr bis Auschwitz, sondern nur noch bis in das Jahr 1949 zurück, so verlören wir das Verantwortungsbewußtsein für das, was in dem Jahrzehnt zuvor im Namen des deutschen Volkes geschehen ist.
(S. 146)
Auf dem direkten Wege staatsbürgerlicher Mitbestimmung in die Verantwortung genommen, ist die Identifikation der Bürger mit den staatlichen Bestimmungen offensichtlich sehr viel größer, als wenn solche Regelungen in einer Repräsentativverfassung quasi von oben auferlegt werden. (S. 203)
Mehr Demokratie wagen
Wenn sich heute so viele Menschen angesichts der großen Risiken der modernen Produktion dennoch gleichsam frei von Verantwortung fühlen, dann wohl deshalb, weil auch diese Risiken ihnen von oben, von sachlichen und fachlichen Autoritäten, von Politikern vorgesetzt werden. Damit in den repräsentativen Demokratien nicht auch die gesellschaftliche Verantwortung nur noch repräsentiert wird, werden wir nicht umhinkönnen, die partizipativen Elemente in diesen Systemen zu stärken. Der Tschernobyl-Prozeß in der Sowjetunion hat gezeigt, wie ein autoritär geführter Staat sich davor drücken kann, die eigene Verantwortung einzugestehen, indem er einige unzulängliche Funktionäre und Ingenieure zu alleinigen Sündenböcken abstempelt und hart bestraft, ansonsten jedoch weiter Atomstrom produziert, als sei gar nichts passiert. Ähnliches könnte sich im Falle eines Falles auch hierzulande abspielen.
Die Freiheit in der Gesellschaft zu bewahren fordert vom Menschen ein Ethos der ökologischen Selbstbeschränkung. Die Fähigkeit zur Selbstbeschränkung wiederum fordert ein verantwortungsbewußtes Individuum. Das zur Verantwortlichkeit nötige Selbstwertgefühl des Menschen aber bildet sich erst in der Auseinandersetzung mit anderen. Wir werden nicht mehr Demokratie erlangen, indem wir ein Reich der Harmonie, der Konflikt- und Herrschaftsfreiheit erträumen. Worauf es ankommt, ist zu lernen, die Konflikte, die es immer geben wird, ja geben muß, möglichst gewaltfrei auszutragen und möglichst schöpferisch zu gestalten. Worauf es ankommt, ist Herrschaft, die es wohl auch immer geben wird, zu beschränken und demokratisch zu kontrollieren.
Mit der Erkenntnis, daß unsere Produkte uns außer Kontrolle geraten, ist auch der linke Traum von der bewußten Machbarkeit der Geschichte in die Krise gekommen: Die Menschen haben die Produkte ihrer Arbeit, das von ihnen "Gemachte" aus den Augen verloren, sie haben das Maß für das Machbare verloren, sie sind zu blinden, Sachzwängen gehorchenden "Machern" geworden. "Machern" mangelt es an Visionen. Auch die Politik hat sich - visionslos - den Sachzwängen gebeugt. Daher die Politikverdrossenheit vieler, daher die Enttäuschung über das Versagen des Staates, das eigentümlicherweise weniger als das Versagen der Verwaltung, sondern mehr als dasVersagen der Parteien empfunden wird.
Parteien sind aber nur ein kleiner Ausschnitt der Gesellschaft. Sie können nicht mehr und nicht weniger "machen" als in der Gesellschaft machbar ist. Der Linken ist seit langem bekannt, daß es nicht Aufgabe allein der Politik sein kann, die Gesellschaft zu verändern. Politik hat lediglich den sozialen Wandel abzusichern, sofern der Wandel positiv ist. Positiv ist im Sinne der Aufklärung, was dem Fortschreiten der Gesellschaft in Richtung Freiheit dient. Eine gute Politik muß demnach die in der Gesellschaft aufkommenden Emanzipationsbestrebungen und -tendenzen aufgreifen und verstärken, wenn nötig kanalisieren oder präzisieren, schließlich institutionalisieren und legalisieren. "In der gegenwärtigen Krise" - sagt Lewis Mumford - "müßten wir, um das Wesen des Menschen zu bewahren und wieder zu erneuern, die Demokratie erfinden, wenn wir sie nicht schon hätten."
Ja, wir müssen mehr Demokratie wagen! (S. 205 f.)
2003 ...
Lafontaine ist raus aus der Spitzenpolitik und versucht über verschiedene Wege, wieder an die Schalthebel zumindest der Produktion von Aufmerksamkeit zu gelangen. Hatte er bei der Auswahl der Buchverlage schon auf Masse gesetzt, so macht er nun bei der BILD-Zeitung als Kommentator Karriere und lässt auch sonst wenig Gelegenheiten aus, auf dem Medienboulevard der Republik zu flanieren.Im Ullstein-Verlag erscheint sein Buch "Die Wut wächst". Lafontaine ist von seinen Positionen des Jahres 1988 völlig herunter. War damals noch die Überwindung von Nationalstaatlichkeit sein Ziel, so vertritt er plötzlich das Gegenteil: Das Wiedererstarken der Nation gegenüber der Globalisierung. Die UNO soll aber auch ausgebaut werden - vor allem auf autoritären Feldern. UNO und NATO als Weltpolizei - Machtwahn des "Napoleons von der Saar". Auszüge:
Im Original: Jahre später noch ein Buch
Die UNO ist die Weltpolizei
Nach den Terroranschlägen auf Amerika sah es zunächst so aus, als wollten die Vereinigten Staaten eigenmächtig handeln und den Angriff auf ihr Land rächen, änderte sich die Situation schon bald. Amerika entdeckte die UNO wieder. jahrelang hatte man die Weltorganisation achtlos zur Seite geschoben. Der Kongress weigerte sich, die amerikanischen Mitgliedsbeiträge für die UNO freizugeben. jetzt wollte George W. Bush eine Entschließung des UNO-Sicherheitsrates. Vor allem Russland, China und die arabischen Staaten wurden von den Amerikanern in die Verhandlungen mit einbezogen. Am Ende stand eine einstimmige Entscheidung des UNO-Sicherheitsrates, die die USA ermächtigte, militärisch gegen die Terroristen und die Staaten, die ihnen Unterschlupf gewährten, vorzugehen. Hatte man im Kosovokrieg noch geglaubt, die UNO links liegen lassen zu können, so wurde sie jetzt hofiert. Vorbei schienen die Zeiten, in denen die ehemalige amerikanische Außenministerin Madeleine Albright lässig bemerkte: "Wir handeln multilateral, wenn wir können, und unilateral, wenn wir müssen." Präsident Bush, der zu Beginn seiner Amtszeit einem gedankenlosen Unilateralismus mit der Parole "America first" Vorschub geleistet hatte, gab nun zu verstehen, der Terrorismus könne einzig in einer Zusammenarbeit mit anderen Staaten bekämpft werden. Dabei hatten manche direkt nach dem Anschlag befürchtet - und manche auch gehofft -, dass jetzt eine neue Ära der nationalen Abschottung einsetzen werde. Konservative träumten davon, die Grenzen wieder dicht zu machen. Aber die fortgeschrittene Globalisierung erlaubt keinen Rückzug auf den Nationalstaat. Aufgaben, die bisher von diesem wahrgenommen wurden, können nur noch von Nationen übergreifenden Institutionen gelöst werden. Schnell also überwies Washington Geld an die UNO und bezahlte einen Teil seiner Schulden. Anschließend wurde John Negroponte zum US-Botschafter bei den Vereinten Nationen bestellt. Monatelang hatte George W. Bush den Posten unbesetzt gelassen. Nach den, Bombenangriffen auf Afghanistan teilte Negroponte dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit, die USA behalte sich das Recht vor, auch andere Staaten, die den Terrorismus unterstützen, anzugreifen. Der amerikanische Präsident warb in einer Rede vor der UNO-Vollversammlung für eine internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terror. Er äußerte sich aber nicht zum Klimaprotokoll, zum nuklearen Teststoppabkommen, zu den Kleinwaffen und zur Biowaffenkonvention Auch den internationalen Staatsgerichtshof klammerte er aus, obwohl gerade dieser dazu geeignet wäre, Terroristen zur Verantwortung zu ziehen. Wenn man es genau nimmt, warb Bush vor den Vereinten Nationen für eine internationale Zusammenarbeit, die von ihm selbst und seiner Regierung abgelehnt wird.
Von vielen wird die UNO infrage gestellt. Als ich im Oktober 2001 in Berlin auf einem Attac-Kongress sprach, wurde ich kritisiert, weil ich für die Anerkennung der UNO-Entscheidungen eintrat. Man hielt mir entgegen, im UNO-Sicherheitsrat seien die größten Waffenexporteure der Welt versammelt. Und Russland und China seien unglaubwürdig, weil sie die Menschenrechte nicht achteten. Aber gibt es eine Alternative zur UNO? Auch wenn viele Staaten der Welt nicht auf Freiheit, Demokratie und Menschenrechte verpflichtet sind, so müssen sie dennoch immer wieder in die Entscheidungen der Internationalen Staatengemeinschaft eingebunden werden. Nach den Angriffen auf Afghanistan verurteilte auch Osama Bin Laden die UNO: "Diejenigen, die SO tun als seien sie arabische Herrscher, und deren Länder Mitglieder der UNO sind, sind Ungläubige, die sich vom Koran und den Lehren der Propheten losgesagt haben, weil sie die internationalen Gesetze dem Koran vorziehen. Diejenigen, die unsere Probleme mit Hilfe der UNO beilegen wollen, sind Heuchler, die Gott, seinen Propheten und die Gläubigen verraten, denn unsere Leiden kommen von der UNO. Wir haben gelitten und leiden noch immer wegen der UNO. Kein Moslem und kein vernünftiger Mensch sollte sich an die UNO wenden, denn sie ist ein Werkzeug des Verbrechens."
Wenn die UNO sich in der Vergangenheit auch öfter zum Instrument der Interessen einzelner Staaten machen ließ, so gibt es dennoch keine Alternative zu ihr. Das Vetorecht einzelner Staaten ist ein Anachronismus. Bei der Reform der UNO-Verfassung sollte es beseitigt werden. Eine neue Satzung muss auch die Aufstellung einer eigenen UNO-Truppe vorsehen. Die Idee, die Vereinten Nationen mit internationalen Streitkräften auszurüsten, besteht schon lange. Sozialdemokratische und sozialistische Parteien hatten solche Vorschläge gemacht. Der Labour-Politiker Arthur Henderson beispielsweise setzte sich in den dreißiger Jahren für die friedliche Beilegung internationaler Streitfragen ein. Dabei forderte er, dass internationale Organisationen auch über die militärischen Mittel verfügen müssten, um notfalls als Weltpolizei fungieren zu können. Henderson erhielt 1934 für seine Tätigkeit als Präsident der Genfer Abrüstungskonferenz den Friedensnobelpreis. Aber die meisten Nationalstaaten, allen voran die USA, sperrten sich gegen solche Vorschläge. Nationale Interessen waren nach ihrer Meinung am ehesten gewährleistet, wenn die eigenen Streitkräfte sie - notfalls militärisch - durchsetzen.
Die außergewöhnlichen Ereignisse in New York und Washington könnten ein Umdenken einleiten. Nicht mehr die Vereinigten Staaten oder Großbritannien würden "Schurkenstaaten" - wie zuletzt den Irak - dazu zwingen, die Beschlüsse der UNO umzusetzen, sondern eine Armee, die der UNO unterstellt wäre. Sie würde aber auch Israel zur Einhaltung der UNO-Resolutionen anhalten. Sie wäre eine Polizeitruppe, die eingesetzt würde, um dem internationalen Recht Geltung zu verschaffen. Wie der nationalen Polizei, wäre es auch der Weltpolizei verboten, bei dein Versuch, Terroristen zu inhaftieren, den Tod vieler Unschuldiger in Kauf zu nehmen. Ein einzelner Staat oder eine Staatengemeinschaft kann von den Betroffenen, gegen die sich eine Militäraktion richtet, immer als parteiisch verurteilt werden. Bei der UNO ist das schwerer. Klare Beschlüsse der Vereinten Nationen wirken wie die Entscheidungen eines unabhängigen Gerichts. Und darum geht es. Kein Staat der Welt könnte dann die Entscheidungen der internationalen Staatengemeinschaft einfach ignorieren. Bei der von vielen geforderten Reform der UNO wäre es sinnvoll, den Einsatz dieser Weltpolizei nicht mehr durch den Sicherheitsrat, den Club der Waffenhändler, sondern durch einen unabhängigen Weltgerichtshof auf Antrag des Sicherheitsrates anordnen zu lassen.
Die UNO wird nicht umhin kommen, überprüfbare Regeln für ihre Polizeiaktionen aufzustellen. Der Krieg ist die Ultima Ratio, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind und moralisch nur gerechtfertigt, um Unschuldige vor Leid zu bewahren. Das ethische Dilemma bleibt: Wer Krieg führt, tötet Unschuldige, um Unschuldige zu schützen. Daher musg die UNO ähnlich wie die Polizei der Nationalstaaten vorgehen. Auf eine Kriegführungsstrategie, die möglichst "keine eigenen Toten" fordert, kann sie sich nicht einlassen. Bei Völkermord und Vertreibung muss sie Sicherheitszonen einrichten. Diese sollten von gut ausgerüsteten Soldaten kontrolliert werden, die notfalls die Schutzbefohlenen mit Waffengewalt vor Übergriffen bewahren. Eine Weltpolizei wäre auch das geeignete Instrument gewesen, um den Völkermord in Ruanda zu verhindern. 1994 waren dort 800 000 Menschen regelrecht abgeschlachtet worden und die UNO hatte kläglich versagt. Ausgelöst wurde der Völkermord durch den Tod des ruandischen Präsidenten Juvenal Habyarimana, dessen Flugzeug abgeschossen wurde. Danach begann die Jagd auf Angehörige der Tutsi-Minderheit und der Hutu-Opposition. Die in Ruanda stationierten UNO-Truppen wurden abgezogen, nachdem zehn belgische Blauhelmsoldaten beim Versuch, Regierungsmitglieder zu schützen, umgebracht worden waren. Die 2500 Blauhelmsoldaten, die in Tigali stationiert waren, durften ihre Waffen nur zur Selbstverteidigung einsetzen. Statt die Zahl der Soldaten aufzustocken, wurde der Rückzug angeordnet, vor allem auf Druck der USA. Der damalige US-Außenminister Warren Christopher hatte seine Diplomaten angewiesen, sich allen Bemühungen entgegenzusetzen, die UNO-Truppen in Ruanda zu halten.
Ähnliches geschah in Srebrenica. Am ii. Juni 1995 hatten serbische Truppen die UNO-Sicherheitszone Srebrenica erobert. Mehr als 7000 muslimische Bosniaken wurden ermordet. Die Frauen und Kinder wurden von den Serben deportiert. Das Massaker hätte von ordentlich ausgerüsteten Friedenstruppen der UNO verhindert werden können. Der kommandierende französische General Bernard Janvier hatte, als die Serben vorrückten, keine Nato-Flugzeuge angefordert. Er wollte die eigenen Soldaten nicht gefährden. Zudem hatten die Niederländer den sofortigen Rückzug ihrer Soldaten aus Srebrenica verlangt. "Wenn wir 400 französische Soldaten in Srebrenica gehabt hätten, dann wäre alles anders verlaufen, weil wir gekämpft hätten", sagte Janvier vor dem Untersuchungsausschuss des französischen Parlaments. Der Ausschuss ging der Frage nach, ob Srebrenica ein Beweis für das Scheitern des Konzepts der Sicherheitszonen war. Er kam zu dem Ergebnis, dass die Ursache des Dramas in der Ausführung und in der Verweigerung angemessener Maßnahmen für die Sicherheitszone lag. Es wäre notwendig gewesen, das internationale Mandat über die Selbstverteidigung in das der Verteidigung der Sicherheitszonen umzuwandeln. Erschreckend ist folgende Feststellung des Ausschusses: "Die französischen Militärs waren nicht aus Prinzip gegen den Einsatz der Luftwaffe, von der sie im Jugoslawienkonflikt selbst Gebrauch gemacht haben. Aber im Gegensatz zu ihren britischen Kollegen sahen sie in ihr auch ein Risiko für die Blauhelmsoldaten. Sie waren also, auch ohne jemals von der Richtlinie 'keine eigenen Toten' beeinflusst zu sein, so sehr mit dem Schutz ihrer Soldaten beschäftigt, dass dieser Konflikt auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen wurde ... Sie standen den Luftangriffen auch deshalb besonders ablehnend gegenüber, da diese von der Nato ausgeführt wurden, einer Organisation also, die von einem Land dominiert wird, das selbst keine Soldaten am Boden hatte, und in aller Offenheit, der Devise 'keine eigenen Toten' folgend, das Leben seiner Soldaten über das Wohlergehen der bosnischen Bevölkerung gestellt hat." Der Ausschussbericht des französischen Parlaments ist eine ungeschminkte Kritik an einer Militärstrategie, die, um das Leben der eigenen Soldaten zu schonen, den Tod von Zivilisten in Kauf nimmt.
Die Konsequenz, die die Nato aus Srebrenica hätten ziehen müssen, wäre nicht die Bombardierung Belgrads gewesen, sondern die Einrichtung von Schutzzonen im Kosovo mit dem klaren Mandat der Vereinten Nationen, diese Schutzzonen militärisch zu verteidigen.
Das Konzept der Sicherheitszonen wurde auch im Afghanistankrieg befürwortet, um die Zivilbevölkerung zu schonen. Aber für die USA galt - nicht anders als im Kosovokonflikt - die Devise: möglichst "keine eigenen Täten". Als eine Friedenstruppe nach Kabul entsandt werden sollte, um die neue afghanische Regierung zu stützen, flammte der Streit über das Mandat der Schutztruppe wieder auf. Zu Recht bestand die deutsche Regierung auf einem Einsatz nach Kapitel 7 der UNO-Charta. Die Soldaten sind bei einem solchen Einsatz berechtigt, militärische Gewalt anzuwenden, wenn sie für die Durchführung des Mandats und die Stabilität des Friedensprozesses unverzichtbar ist. Die Vertreter der Nordallianz - unter anderem Außenminister Abdullah Abdullah und Militärminister Mohammed Fakhim - wollten hingegen ein Mandat nach Kapitel 6 der UNO-Charta. Bei einem solchen Mandat dürfen die Soldaten nur handeln, wenn die afghanische Regierung entsprechende Anweisungen gibt. Abdullah verlangte auch in einem Brief, die Stärke der Friedenstruppe auf 600 bis 1000 Soldaten zu begrenzen. Das war ein schlechter Scherz. Die britischen Militärs waren ursprünglich von einer Friedenstruppe von 50 000 Mann ausgegangen, eine ähnliche Anzahl von Soldaten ist im Kosovo stationiert. Die militärische Stärke der Truppen der Nordallianz brachte die Staatengemeinschaft in eine schwierige Situation. Die Amerikaner wollten sich an der Friedenstruppe nicht beteiligen, die europäischen Mittelmächte hatten den Mund zu voll genommen. Mit allerlei Tricks versuchten sie den Konsequenzen ihrer vorlauten Ankündigungen zu entgehen. Die Briten wollten die Friedenstruppe in die amerikanische Führungsstruktur einbinden, weil die US-Verbände notfalls den Soldaten, die den Frieden überwachen, beistehen sollten. Da London damit rechnete, dass die Amerikaner sich nach wenigen Monaten aus Afghanistan zurückziehen würden, wollten sie den Friedenseinsatz auf drei Monate beschränken. Dies war ähnlich unseriös wie das Ersuchen der Nordallianz, eine schwache "Peacekeeping"-Truppe nach Kabul zu schicken, die im Ernstfall der militärischen Übermacht der Warlords ausgeliefert wäre. Der gefundene internationale Kompromiss einer "kleinen Sicherheitszone", an deren Schutz sich auch die Bundeswehr beteiligte, führte zu folgendem Ergebnis: Die Regierung in Kabul wird geschützt, im Rest des "befreiten" Landes wird weiter gemordet.
Die UNO ist eher in der Lage, Frieden zu stiften, als ein einzelner Staat, weil sie nicht mit so vielen Hypotheken aus der Vergangenheit belastet ist. Die muslimische Welt wirft dem Westen, insbesondere den Vereinigten Staaten, zu Recht Doppelmoral vor. Im Iran unterstützten die Amerikaner den Schah, statt auf die demokratischen Kräfte zu setzen. Gegen den Iran wurde, wie erwähnt, Saddam Hussein aufgerüstet. Der Diktator war lange Zeit ein guter Kunde der amerikanischen und westlichen Waffenindustrie. Aber nicht nur Saddam Hussein, sondern auch die der Nato angehörende Türkei verfolgt die Kurden. In den letzten zehn Jahren wurden 30 000 Kurden umgebracht. Die dabei eingesetzten Waffen kamen zum größten Teil aus den USA. Wo ist da der Unterschied zu Saddam Hussein, fragen viele Muslime. Die Vereinigten Staaten, die vorgeben, in aller Welt für Demokratie und Freiheit einzutreten, sehen in der korrupten Dynastie Saudi-Arabiens einen wichtigen Verbündeten. Ebenfalls widersprüchlich ist ihre Haltung gegenüber der atomaren Bewaffnung kleinerer Länder. Israel verfügt über Atomwaffen, ohne dass sich die USA daran stören. Gleichzeitig werden so genannte Schurkenstaaten wie der Iran oder Nordkorea mit Krieg bedroht, wenn sie sich ABC-Waffen zulegen wollen.
Die Vereinten Nationen als Weltpolizei sollten nicht nur über militärische Fähigkeiten verfügen. Bei jedem lokalen Krieg wurde deutlich, dass die technischen Fähigkeiten, Leben zu zerstören, weitaus größer sind als die Fähigkeiten, Menschen zu retten oder Umweltkatastrophen zu bekämpfen. Deshalb wurden für die UNO nicht nur Kampftruppen und Blauhelme, sondern auch Grünhelme gefordert. Als Saddam Hussein im Golfkrieg 1991 das Meer mit Öl verseuchte, fehlte es an technischem Gerät und ausgebildetem Personal, um die Katastrophe einzudämmen. Daher wurde angeregt, die UNO solle eine Einheit aufbauen, die Aufgaben übernehmen kann, die bei uns vom Technischen Hilfswerk und vom Roten Kreuz wahrgenommen werden. Leider ist das Denken in militärischen Kategorien wieder so bestimmend geworden, dass die Forderung nach Grünhelmen schon in der Debatte über den krieg in Afghanistan nicht mehr auftauchte. Der Terrorismus ist langfristig nur mit politischen und wirtschaftlichen Mitteln zu bekämpfen. In diesem Sinne forderte der Politikwissenschaftler Chalmers Johnson: "Das Politikmachen muss den Militärplanern und militaristisch gesonnenen Zivilisten entzogen werden, die heute Washingtons Politik beherrschen." Aber nicht nur in Washington machen militärisch gesonnene Zivilisten Politik. (S. 79 ff.)
Die Zukunft der Nato
Die Nato ist ein Verteidigungsbündnis. Ich habe die Nato aber nicht nur als ein Bündnis gegen den Warschauer Pakt begriffen, sondern als eine Vorläuferin der Vereinten Nationen als zukünftiger Weltpolizei. Der Nato-Vertrag beruft sich auf die Grundsätze der UNO, auf die Freiheit, die Demokratie und die Herrschaft des Rechts. Solange die Weltorganisation keine eigenen Streitkräfte hat, kann die Nato im Auftrag der Vereinten Nationen handeln. Dabei muss sie immer das internationale Recht beachten. Aus Brüssel hörte man in den ersten Wochen des Afghanistankriegs kaum etwas. Das war schon erstaunlich, hatte man doch zum ersten Mal den Bündnisfall nach Artikel 5 des Nato-Vertrags festgestellt. Darin hatten Nato-Mitgliedstaaten vereinbart, dass ein Angriff auf einen oder mehrere von ihnen als ein Angriff auf sie alle angesehen wird. (S. 87)
Internationaler Strafgerichtshof
Ein unabhängiger Internationaler Strafgerichtshof würde die Terroristen aller Länder bedrohen und somit zur Befriedung der Welt beitragen. Die Sache hat nur einen Haken. Die Vereinigten Staaten legen sich quer. Am 17. Juli 1998 kamen in Rom Delegierte aus allen Staaten der Welt zusammen, um die Einrichtung eines internationalen Strafgerichtshofes zu vereinbaren. Dieser sollte Militärs und Politiker, denen Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, zur Rechenschaft ziehen. (S. 122)
Die Globalisierungskritiker sind keine Gegner der Marktwirtschaft. Sie haben nur erkannt, dass die unsichtbare Hand des Marktes die sichtbare starke Hand des Staates braucht. Der Marktfundamentalismus untergräbt die Demokratie. (S. 211)
Amerika ist das Kraftzentrum der Welt. Der oft verwendete Begriff der Globalisierung ist ein anderes Wort für das Vordringen der amerikanischen Vorherrschaft und Lebensweise auf dem Erdball. Die Hegemonie der Vereinigten Staaten ist nicht nur militärisch und wirtschaftlich, sondern auch kulturell. (S. 268)
Da England sich nicht zwischen Amerika und Europa entscheiden kann, müssen Deutschland und Frankreich das Heft in die Hand nehmen. Eine deutsch-französische Konföderation, der sich die Benelux-Staaten anschließen können, wäre der Beginn einer neuen Rolle Europas in der Weltpolitik. Männer wie Charles de Gaulle und Konrad Adenauer hatten ein Gespür für den historischen Auftrag des alten Kontinents. Valery Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt ebenso wie Francois Mitterrand und Helmut Kohl haben die deutsch-französische Zusammenarbeit zum Motor der europäischen Entwicklung gemacht. Dieser Motor stottert zur Zeit. Aber die politische Aufgabe bleibt. Zwar wird es schwer sein, im Zeitalter medialer Eitelkeit und der Vorherrschaft nationaler Wahlkämpfe einen Durchbruch zu erreichen. Aber eine deutschfranzösische Konföderation, die eine institutionalisierte gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ebenso umfasst wie eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik, kann Europa zu einem Partner werden lassen, der die Politik Amerikas ausgleicht und korrigiert. Ein solches Vorhaben kann nur gelingen, wenn es von einer neuen geistigen Orientierung getragen wird. (S. 271)
2006 ...
Lafontaine auf dem Weg nach oben. Er wird wieder Parteichef. Dabei behauptet er, dass diese nächste Partei, deren Boss er ist, das gleiche Programm vertritt, wie die andere, wo er Boss war - also die SPD vor 1998. Das sagt eigentlich alles, denn die SPD vor 1998 war für Sozialabbau, für Ausbau der Sicherheits- und Kontrollsysteme, unterstützte Kriegseinsätze und mehr. Nur moderater, etwas langsamer, aber damit auch geräuschloser. Lafontaine veröffentlicht das Buch "Politik für alle". Mit seinen politischen Aussagen passt er sich wieder seiner neuen Rolle an. Ganz auf Linie von Attac, Hartz-IV-Protesten und sozialpolitischen Debatten bedient er alle: Sozialneid gegen AusländerInnen, Globalisierungsängste, Sehnsucht nach einer Heimat - die Nation als identitäres Konzept einer Gesamtgesellschaft erscheint in Logiken eines Brieftaubenvereins. Auszüge:Im Original: Das nächste Buch von Lafontaine
Die Charta der UNO sieht eine ständige internationale Streitmacht vor, die vom Sicherheitsrat eingesetzt werden kann. Eine solche Streitmacht ist leider bis zum heutigen Tag nicht entstanden, weil die militärisch starken Mitgliedsstaaten, allen voran die USA, vorzugsweise eine eigene Machtpolitik verfolgen. An diesem Punkt spätestens kommt die deutsche Politik ins Spiel: Sie muss auf die Existenz einer der UNO unterstehenden internationalen Streitmacht drängen, weil nur auf diese Weise die Vereinten Nationen von allen Völkern als internationale Polizei akzeptiert werden können.
Der Aufbau einer derartigen Weltpolizei, an der Deutschland sich beteiligen muss, ist genauso wichtig wie die Änderung der Zusammensetzung des Sicherheitsrates. (S. 178 f.)
Erste Pflicht der deutschen Politik ist es, auf die Durchsetzung eines internationalen Rechts zu drängen, das für alle Staaten verbindlich ist. Ohne eine solche Rechtsordnung kann es keinen Frieden geben. Auch international gilt: Die Freiheit des Stärkeren führt zur Unterdrückung. Das Recht schützt die Freiheit der Schwächeren. (S. 181)
Ausländer und wir
Vor einigen Jahren eröffneten CDU-Politiker eine Debatte über die deutsche Leitkultur. Und da jedes Jahr viele Einwanderer zu uns kommen, lebte die Debatte wieder auf. Es geht dabei um die Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung. Berichte machen die Runde, in denen die Schwierigkeiten dargestellt werden, die sich im Alltagsleben bei der Integration der Ausländer ergeben. In einzelnen Städten ist von einer Ghettoisierung die Rede. Eltern beklagen sich, ihre schulpflichtigen Kinder würden in Klassen unterrichtet, in denen die Ausländerkinder in der Mehrheit seien. Auch die als Deutsche bezeichneten Aussiedler, deren Vorfahren vor Jahrhunderten nach Osteuropa ausgewandert waren, haben Probleme, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden.
Über drei Millionen Aussiedler sind zwischenzeitlich, vor allem auf Betreiben der CDU/CSU, nach Deutschland gekommen. Aber bei den Menschen, die erst in den letzten Jahren umsiedelten, stellte man fest, dass die Mehrheit von ihnen die deutsche Sprache genauso wenig beherrscht wie die Zuwanderer aus anderen Ländern. Aus diesem Grund häufen sich die Schwierigkeiten.
Zuwanderer haben in der Regel keine besonders guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sie sind vielfach abhängig von sozialen Leistungen. Isolation, Drogenkonsum, Aggression sowie eine mangelnde Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft seien die unmittelbaren Folgen, so bilanziert das Bundesministerium. Bundespräsident Köhler warnte in seiner Antrittsrede vor der Gefahr der Entwicklung von Parallelgesellschaften in unseren Stadtteilen, da eine Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion anscheinend nicht gelinge. So stammen von den 2,5 Millionen Türken, die in Deutschland leben, 85 Prozent aus sozialschwachen Schichten. Mehrheitlich sind ihre Jobs niedrig qualifiziert. Rund 18 Prozent der türkischen Haushalte beziehen Arbeitslosen- oder Sozialhilfe. Man entdeckt jetzt wieder, dass die Beherrschung der deutsche Sprache eine wichtige Voraussetzung ist, um sich in unserem Land zurechtzufinden. Sprachkurse sollen verstärkt angeboten werden, um den Neubürgern die Möglichkeit zu geben, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Es bleibt allerdings meist bei den guten Vorsätzen. Die Parteien überbieten sich stattdessen mit Steuersenkungsvorschlägen, und Kassenwart Hans Eichel gefällt sich in der Rolle des "Sparminators". Im Steuersenkungsland Deutschland sind die Kassen leer.
Die Bildung von Parallelgesellschaften kann als eine Begleiterscheinung der fortschreitenden Globalisierung begriffen werden. Der amerikanische Politologe Samuel Huntington sieht diese Entwicklung ebenfalls in den Vereinigten Staaten. Bisher, so seine Analyse, wollten die Einwanderer Amerikaner werden, folglich hätten sie sich assimiliert. Von diesem Verhalten ist bei den Hispanics und Latinos, die in jüngster Zeit in die Staaten eingewandert sind, nichts mehr zu spüren. Spanisch, so Huntington, werde zu einer parallel benutzten Sprache in einem "Parallel-Amerika". Im Präsidentschaftswahlkampf 2004 sprachen Bush und Kerry ihre Wähler auch schon auf Spanisch an. Da fragt man sich, wann Spitzenpolitiker in Europa bei Wahlkämpfen die Zuwanderer in ihrer Heimatsprache umwerben.
Am 6. Oktober 2001 zerbrach für viele Franzosen das bis dahin gepflegte Bild einer Nation, nach dem in Frankreich jeder, ganz gleich, welcher Herkunft oder Religion er ist, Bürger der französischen Republik ist. Im Pariser Stadion "Stade de France" spielte der Fußballweltmeister Frankreich gegen Algerien. Tausende von jugendlichen algerischer Abstammung pfiffen die französische Nationalhymne, die Marseillaise, aus und randalierten. Die Integration der mehr als vier Millionen Moslems sei total gescheitert, meinte Regierungssprecher Jean-Francois Copé nach dem Spiel.
Die hiesigen Bemühungen um die Wählerstimmen der Neubürger führten zu dem Vorschlag des Grünen-Abgeordneten Hans-Christian Ströbele, auch einen muslimischen Feiertag gesetzlich festzulegen. Ich stehe diesem Vorschlag ablehnend gegenüber, da religiöse Festtage die Gläubigen versammeln, aber die Nicht-Gläubigen außen vor lassen. Solange sich in Nordirland noch Protestanten und Katholiken die Köpfe einschlagen, sollten wir das Trennende der unterschiedlichen Religionen nicht kultivieren. Zudem richtet die Einteilung der Bürger in Gläubige und Ungläubige auf der ganzen Welt großes Unheil an. Mit anderen Worten: Die Religionen führen viele dazu, Menschen, die einen anderen Glauben praktizieren, ablehnend bis feindselig gegenüberzustehen. Besonders wenn Menschen durch Arbeitslosigkeit und Armut sozial ausgegrenzt werden, suchen sie Halt in ihren religiösen Traditionen. An dieser Nahtstelle der modernen Gesellschaft zeigt sich erneut: Die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, Armut und gesellschaftlicher Ausgrenzung ist eine Voraussetzung, um das friedliche Zusammenleben von Menschen zu ermöglichen, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen stammen. In einem Land hoher Arbeitslosigkeit ist es deshalb fahrlässig und töricht, eine weitere Zuwanderung zu fordern.
Die Zuwanderung als Folge der Globalisierung führt letztlich zu der Frage, wer gehört eigentlich zur deutschen Nation? Die Rechte wollte die Nation immer vor Fremden abschotten. Lange Zeit versteiften sich die Unionsparteien darauf, Deutschland sei kein Einwanderungsland. Die Linke in Deutschland wollte dagegen die Nation durch Einwanderung und damit durch eine kulturelle Öffnung bereichern. Der Multikulturalismus wurde in ihrem Weltbild zu einer Leitvorstellung gesellschaftlichen Zusammenlebens. Seit einigen Jahren hat sich jedoch vieles verändert. Heute reden auch Unionspolitiker wie selbstverständlich darüber, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Die Wirklichkeit wird nicht mehr geleugnet. Und seit dem Asylkompromiss wissen auch SPD und Grüne, dass es notwendig ist, die Zuwanderung zu steuern und zu regeln.
(S. 232 ff.)
Die Nation: Eine Gemeinschaft mit Rechten und Pflichten
Das Wort "Nation" stammt von dem lateinischen Wort natio, Geburt. Demzufolge gehören all die Menschen einer Nation an, die in dem betreffenden Land geboren wurden. In vielen Staaten der Welt ist der Geburtsort für die Staatsbürgerschaft das wichtigste Kriterium. In Deutschland und Israel zählt dagegen immer noch die Abstammung. Man unterscheidet im Staatsbürgerschaftsrecht zwischen dem ius-soli und dem lus-sanguinis. Nach dem ius-soli ist für die Staatsbürgerschaft der Geburtsort ausschlaggebend, nach dem ius-sanguinis die Blutsverwandtschaft, die Abstammung. Die Bürger, die in dem Land geboren wurden, dessen Pass sie besitzen, sprechen unabhängig von ihrer Abstammung und Religionszugehörigkeit die einheimische Sprache. Bei den Bürgern, die ihren Pass der Abstammung verdanken, ist das oft nicht der Fall. Die Trennlinie zwischen gemeinsamer Abstammung und rassistischer Ausgrenzung ist dabei unscharf Eine Überbetonung des gemeinsamen Blutes führte nicht nur in Deutschland zu den grausamen Verbrechen ethnischer Säuberungen. Aus diesem Grund habe ich dem ius-soli immer den Vorzug gegeben.
Der deutsche Aufklärer Johann Gottfried Herder führte den Begriff der Kulturnation ein, und die Gebrüder Grimm träumten von einer deutschen Nation aus dem Geiste der gemeinsamen Sprache. Aber die deutsche Sprache und die deutsche Kultur existieren auch außerhalb der Grenzen unseres wiedervereinigten Landes. Betrachten wir nur die deutschen Lyriker: Rainer Maria Rilkes Geburtsort ist Prag, der von Paul Celan liegt in Rumänien und Ingeborg Bachmann kam in Österreich zur Welt. Die Religionskriege der Vergangenheit und der heutigen Zeit aber haben gezeigt, es reicht nicht aus, eine gemeinsame Sprache zu sprechen, um Menschen dazu zu bringen, sich als einander zugehörig zu fühlen. Das gilt für den Vorderen Orient ebenso wie für Nordirland und das ehemalige Jugoslawien. Die Vorstellung einer Kulturnation ist faszinierend, da sie in ihren Grundannahmen die engen Grenzen des Nationalstaates überschreitet. Wenn aber darüber entschieden werden soll, wer ein Staatsbürger ist und wer nicht, dann hilft sie nicht weiter.
Oft rede ich mit Leuten, die allzu naiv auf der identitätsstiftenden deutschen Lebensweise beharren. Dann frage ich sie: "Was zeichnet denn überhaut unsere Leitkultur aus? Besteht sie darin, dass wir zum Italiener essen gehen? An der nächsten Döner-Bude Halt machen, um einen Imbiss mitzunehmen? Oder einer Bundesliga-Mannschaft zuschauen, in der die Deutschen in der Minderheit sind?" Wenn schließlich noch die berühmten deutschen Tugenden aufs Tapet kommen, erinnere ich an Steuerhinterziehung, Versicherungsbetrug, Schwarzarbeit und den Missbrauch sozialer Leistungen.
In diesem Zusammenhang wird immer wieder auf die Wichtigkeit der vermeintlich deutschen Sekundärtugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit und Verlässlichkeit hingewiesen. Der CSU-Generalsekretär Markus Söder zum Beispiel hatte die Bürger dazu aufgefordert, sich wieder auf die deutschen Tugenden Leistungsbereitschaft, Pünktlichkeit und Disziplin zu besinnen. Die Präsidentin der Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, Gesine Schwan, gab darauf die richtige Antwort. In einem Interview mit dem Münchner Merkur sagte sie, zwar schätze sie diese Tugenden. Aber sie wisse, "dass diese in der deutschen Geschichte fürchterlich missbraucht worden sind". Man könne auch "sehr fleißig und diszipliniert töten".
Der Versuch, die eigene Kultur zu bestimmen, ist nicht einfach. Im Zeitalter der Individualisierung gibt es Lebensentwürfe, die der Mehrheit der Menschen fremd sind, die aber in einer toleranten Gesellschaft jedem Einzelwesen zugestanden werden. Bleibt also alles im Ungewissen?
Ein brauchbarerer Begriff zur Bestimmung der Staatsbürgerschaft ist der des Verfassungspatriotismus. Er beinhaltet Folgendes: Wer sich zu den Zielen einer Verfassung bekennt, erfüllt die Voraussetzungen, Staatsbürger zu sein. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Respektieren der Menschenwürde. Der Verfassungspatriotismus will mithin die durch Religion und Abstammung entstandenen Trennungslinien überwinden. Da die Wanderungsbewegungen in der Welt eher zunehmen und nicht abnehmen werden, ist das Bekenntnis zu den Werten und den Grundsätzen einer Verfassung eine gute Basis für das Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher Abstammung und unterschiedlicher Religionszugehörigkeit. Aber der Begriff des Verfassungspatriotismus reicht letztlich ebenso wenig aus wie der Begriff der Kulturnation, um zu bestimmen, wer zu unserem Staat gehört. Denn die Werte unserer Verfassung sind letztlich die Werte aller westlichen Demokratien.
Der Nationalstaat wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle -für das Zusammenleben der Menschen spielen. Wir dürfen nicht vergessen, wie viele Jahrhunderte es dauerte, bis sich die Nationalstaaten in Europa herausgebildet hatten. Daher wird auch noch viel Zeit vergehen, bis sie sich wirklich zu Gunsten der Vereinigten Staaten von Europa auflösen werden. Wenn aber die universalen Werte der Verfassung, die gemeinsame Kultur oder die gemeinsame Abstammung im Zeitalter der Globalisierung nicht mehr konstituierend sind für das Recht auf die Staatsbürgerschaft, was soll dann an ihre Stelle treten?
Schon gibt es Stimmen, die behaupten, im 21. Jahrhundert sei das entscheidende Dokument nicht mehr die Geburtsurkunde, sondern der Reisepass, da die Globalisierung zu einer unglaublichen Mobilität und Wanderungsbewegung geführt habe. So werden, nur um eine Zahl zu nennen, ungefähr 2,6 Milliarden Menschen jährlich von den Fluggesellschaften befördert. Noch wichtiger sei aber - laut diesen Stimmen - folgende Tatsache: Die USA, Kanada und Australien hätten im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts 22 Millionen Einwanderer aus allen Teilen der Welt aufgenommen. Im selben Zeitraum wären elf Millionen Einwanderer nach Westeuropa gekommen. Dieser Prozess würde auch weiter anhalten und zu einer Kosmopolitisierung der Großstädte in den Industriestaaten führen. Das Zeitalter ethnisch weitgehend homogener Nationalstaaten - wenn es sie denn jemals gab - sei zu Ende. Die doppelte, ja, die mehrfache Staatsangehörigkeit würde zunehmen. Und entsprechend würde die Loyalität der Bürger zum Nationalstaat nachlassen. So pendeln viele wohlhabende Migranten zwischen dem Land, das ihnen Arbeit gibt, und der alten Heimat hin und her.
Dennoch gibt es keinen globalen Arbeitsmarkt. Selbst die klassischen Einwanderungsländer USA, Kanada oder Australien können keinen freien Arbeitsmarkt ausrufen. Daher bleibt die Staatsbürgerschaft für viele Menschen auch in Zukunft ein Anker.
Der Staatsbürger hat seinen Beitrag zum Funktionieren seines Staates zu leisten. Dabei könnten wir uns neben der gemeinsamen Kultur und Geschichte und einem Bekenntnis zu den Werten der Verfassung auch an dem Vorbild einer Vereinsmitgliedschaft orientieren. Das klingt im ersten Moment zwar banal, hat aber den Vorteil einer leichteren Verständlichkeit.
Diejenigen, die sich zu einem Verein zusammenschließen, geben sich eine Satzung und begründen für die Mitglieder Rechte und Pflichten. Die Bundeswehr schützt die Deutschen beispielsweise im Falle einer äußeren Bedrohung. Die Polizei sorgt dafür, dass Gesetze beachtet und der innere Frieden gewahrt werden. Die öffentlichen Kindergärten, Schulen und Universitäten sichern den Staatsbürgern eine gute Ausbildung. Das Gesundheitswesen ermöglicht jedem, ob arm oder reich, eine medizinische Versorgung. Der Sozialstaat gibt den Menschen Sicherheit, wenn sie alt, krank, arbeitslos oder ohne Einkünfte sind.
Die Staatsbürgerschaft gibt also jedem das Recht, die Leistungen des Staates in Anspruch zu nehmen. Und hier, in diesem Zusammenhang, hilft der Verweis auf den 'erein weiter. Mitglied in einem Verein ist derjenige, der satzungsgemäße Beiträge zahlt. Gemessen daran liegt bei der deutschen Nation einiges im Argen. Zu viele verweigern den Vereinsbeitrag, weil sie Steuern hinterziehen, schwarz arbeiten oder sich als besser Verdienende nicht an der Finanzierung des Sozialstaates beteiligen. Genau an dieser Stelle versteht man, warum es ärgerlich ist, wenn die deutschen Nationalhelden - wie die Schumacher-Brüder, Jan Ullrich und viele andere Show-Größen - ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen.
So sieht es logischerweise auch die Steuerverwaltung. Die prüft, ob der Lebensmittelpunkt dieser Prominenten wirklich Monaco ist - oder eine andere Steueroase - und nicht doch eine bundesdeutsche Großstadt. Zu oft hatten sich deutsche Staatsbürger mit höherem Einkommen nur einen "Briefkasten" in einem Land mit geringen Steuersätzen besorgt. Auf diese Weise gestaltete auch der populäre Sänger Freddy Quinn sein Leben. Er hatte von 1998 bis 2002 Steuern in Höhe von 900 000 Euro hinterzogen, weil er in der Schweiz gemeldet war, aber in Hamburg wohnte. Er wurde zu einer Steuernachzahlung und einer Geldbuße verurteilt und gelobte Besserung.
Es geht bei den Vereinsbeiträgen der Bundesrepublik wohlbemerkt nicht nur um Steuern, sondern auch um Sozialabgaben. Die deutsche Einheit, so hieß es nach dem Fall der Mauer, sei ein Glücksfall. Viele der besser Verdienenden weinten gar vor Glück, als die Mauer fiel. Gleichzeitig beteiligen sie sich aber nicht oder nur in geringem Umfang an der Finanzierung des Glücks, weil sie keine Sozialbeiträge zahlten und zahlen. Die Regierung Kohl hat nämlich den Fehler gemacht, die deutsche Einheit zum größten Teil aus den Sozialkassen zu bezahlen. Ärgerlicherweise hat sich bis zum heutigen Tage wenig daran geändert.
Das deutsche Volk ist eine Schicksalsgemeinschaft, heißt es, wenn über unsere Nation gesprochen wird. Sind wir das wirklich? Die Folgen dieses letzten großen historischen Datums, das der deutschen Vereinigung, tragen überwiegend die Arbeitnehmer. Was ist das für eine Schicksalsgemeinschaft, in der sich die Leistungsstärksten davor drücken, ihren Beitrag zur Wiedervereinigung des eigenen Landes zu leisten? Welche Bande halten die Nation zusammen, wenn bei jedem Verteilungskonflikt gedroht wird, den Betrieb ins Ausland zu verlagern? Es hilft auch nicht viel, wenn die christliche Prägung unseres Landes beschworen wird. Die zunehmende Individualisierung widerlegt die Behauptung, die Botschaften des Jesus von Nazareth seien in unserem Land lebendig. Das Christentum ist die Religion der Nächstenliebe, und verweist es die Gläubigen nicht auf ihre Eigenverantwortung.
Nun gibt es einige Einkommensmillionäre, die brav ihre Steuern zahlen. Diese verweisen auf ihre Steuererklärung und meinen, sie hätten damit dem Kaiser gegeben, was des Kaisers ist. Dem ist grundsätzlich entgegenzuhalten: Das deutsche Steuerrecht ist nicht fair, und an der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme beteiligen sich besser Verdienende nur in einem geringen Umfang und Beamte und Selbständige überhaupt nicht.
Steuersystem und Sozialstaat gehören aber untrennbar zusammen. Der Ansatz, die Finanzierung des Sozialstaates von den Arbeitseinkommen abzukoppeln und sie über Steuern sicherzustellen, setzt ein gerechtes Steuersystem voraus. Dieser Gedanke, so richtig er ist, scheint unseren Reformern jedoch fremd zu sein. Sie wollen, man muss nur an die Kopfpauschale der CDU denken, die ausgleichende Gerechtigkeit über steuerfinanzierte Zuschüsse für Geringverdiener herstellen, zugleich aber wollen sie das Steuersystem über das Bierdeckel-Steuermodell des Friedrich Merz noch ungerechter machen. Mittlerweile haben auch sozialdemokratische Politiker das Argument des Bundes der Steuerzahler übernommen, um die Gerechtigkeit unseres Steuersystems zu belegen: Zehn Prozent der Einkommensbezieher, so sagen sie, zahlen fünfzig Prozent der Lohn- und Einkommenssteuer. Das sei doch der Beweis, dass in Deutschland von oben nach unten umverteilt würde. Wie sollte es auch anders sein, wenn unter den zehn Prozent, die die Hälfte der Einkommenssteuern aufbringen, viele sind, die ein Mehrfaches, manchmal ein Hundertfaches eines Arbeitnehmers an Einkommen beziehen? Tatsache ist ja: Wenn der Einkommensmillionär mit einigen Abschreibungsobjekten hunderttausend Euro Steuern und Abgaben zahlt und ein Facharbeiter mit 40000 Euro Lohn über Steuern und Abgaben rund 25000 Euro an den Fiskus abführt, dann trägt der Millionär, verglichen mit dem Facharbeiter, die vierfache Last. Und die deutschen Reformer und Modernisierer sind damit höchst zufrieden, weil sie nicht bemerken, dass der Millionär zwar mehr zahlt, aber im Verhältnis nur jeden zehnten Euro abgibt, während der Facharbeiter mehr als Jeden zweiten Euro abtreten muss. Welche Schlüsse ziehen wir daraus?
Die Staatsangehörigkeit sollte all jenen zustehen, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben, die deutsche Sprache sprechen, nach ihrer Leistungsfähigkeit Steuern zahlen und den Sozialstaat finanzieren. So wird eine Gemeinschaft mit Rechten und Pflichten begründet. Aus diesen Rechten und Pflichten ergibt sich auch die Notwendigkeit, die Zuwanderung zu begrenzen. Weil der Sozialstaat überwiegend von den Arbeitnehmern mit geringem und mittlerem Einkommen finanziert wird, findet man auch in dieser Gruppe die größten Widerstände gegen Aussiedler, Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber. Denn die Zuwanderung bedeutet immer Konkurrenz um Arbeitsplätze, Wohnungen und Lebenschancen. Deshalb muss in einer modernen Nation die Verpflichtung des Staates garantiert werden, zuallererst für diejenigen zu sorgen, die seine Bürger sind und sich, soweit sie Einnahmen haben, an der Finanzierung der Gemeinschaft beteiligen.
Die forcierte Zuwanderung wird in Deutschland einzig von den oberen Zehntausend gefordert, die von deren Folgen gar nicht oder nur am Rande betroffen sind. Sie konkurrieren nicht um Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich. Sie haben kein Problem, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Sie schicken ihre Kinder auch nicht auf Grundschulen, in denen die Zahl der Ausländerkinder überwiegt. Die deutschen Wirtschaftseliten exportieren Arbeitsplätze, weil in anderen Ländern die Löhne niedriger sind, und befürworten eine Zuwanderung, um das deutsche Lohnniveau zu drücken.
Der Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration schlug im Jahr 2004 vor, für 2005 25000 zusätzliche ausländische Arbeitskräfte anzuwerben. Vor allem im Gesundheitsbereich, im Ingenieurswesen sowie bei Banken und Versicherungen bestehe ein Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften. Das wird in einem Land behauptet, in dem Banken und Versicherungen viele Stellen abbauen und in dem durch das Schließen von Kliniken und Arztpraxen viele Arbeitsplätze verloren gehen und 70 000 Ingenieure arbeitslos sind. Die fünf Millionen Arbeitslosen und jene Millionen von Menschen, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben, verstehen solche Ratschläge unserer Eliten schon lange nicht mehr. (S. 236 ff.)
- Artikel "Schnittmengen" mit Zitatenvergleiche zwischen Linken und Rechten, u.a. von Lafontaine - in: konkret, 4/2006 (S. 28ff.)
Der Trickser
Eine unglaubliche Story: Lafontaine, WASG-Mitglied und als solcher Teil des Spitzen-Duos der gemeinsamen Fraktion im Bundestag, wirbt auf seiner Seite Mitglieder. Ist sicherlich nicht überraschend. Interessant aber, dass wer sich dort anmeldet, in der Linkspartei landet und nicht in der WASG. Die Auflösung dieser Partei ist also offenbar auch in Lafontaines Kopf längst beschlossene Sache ... mehr auf dieser Internetseite mit allen Belegen!Der Führer
Aus "Vorteil Lafontaine" des Querfrontlers Jürgen Elsässer, in: Junge Welt, 2.5.2006 (S. 8)
Was puristische Basisdemokraten oft verkennen: Nur unter Führung von solchen Volkstribunen können Menschen gewonnen werden, die vom Sozialismus bisher nichts wissen wollen. Manchmal braucht es am Anfang etwas Personenkult, um die selbsternannte Avantgarde beiseite zu schieben und den politischen Raum für die Massen zu öffnen. ...
Genauso kraftvoll, wie Lafontaine und Co. gerade die Linkssektierer der WASG in die Schranken gewiesen haben, müssen sie jetzt gegen die Rechtsabweichler in der Linkspartei vorgehen. ...
Die frühere PDS bewegt sich nach links.
Im Berliner Wahlkampf 2006 machte Lafontaine Werbung für die Linkspartei. Eigentlich ist Lafontaine in der WASG. Normalerweise wird mensch rausgeworfen für Werbung zuungunsten der eigenen Partei. Lafo natürlich nicht, im Gegenteil. Seine Wahlkampfauftritte waren eher dürftig. Das kommentierte die Junge Welt in "Oskars Wunschzettel" am 18.8.2006 (S. 6)
Das allerdings wäre fatal, stellt Lafontaine gleich eingangs klar. "Die Alleinkandidatur der WASG in Berlin ist weder taktisch noch strategisch zu rechtfertigen." Schließlich könnte ein Wahlerfolg der WASG die Linkspartei aus der Regierung kippen, und "nur die Linke.PDS kann verschärften schwarz-gelb-grünen Sozialabbau verhindern", meint der Saarländer. Damit ist schon fast alles gesagt: Es geht um die Wahl des kleineren Übels. Der Rest sind fromme Wünsche auf Oskars Agenda, die sich gut anhören, aber immer unschärfer werden, je konkreter man nachfragt.
Die Linke.PDS, erklärt Lafontaine, stelle sich "gegen die Privatisierung der Berliner Sparkasse". Man reibt sich die Augen: Die Novelle zum Berliner Sparkassengesetz von 2005 hatten sich Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) und Wirtschaftssenator Harald Wolf (Linkspartei.PDS) von der Wirtschaftskanzlei Freshfields formulieren lassen, einer Agentur, die seit Jahren im Auftrag privater Großbanken Expertisen für die Privatisierung öffentlicher Sparkassen erarbeitet. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Banken, Klaus-Peter Müller, lobte das "rot-rote" Gesetz öffentlich als "Meilenstein" bei der Zerschlagung des öffentlichen Bankensektors. Doch diese Niederungen konkreter Politik fechten Lafontaine nicht an: Man werde "alle Möglichkeiten ausschöpfen", um den Verkauf der Sparkasse an den privaten Bankensektor zu verhindern. Welche Möglichkeiten? Na, "alle" eben. Noch Fragen?
Lafontaine früher über die PDS
Erbschleicher Gysi
Lafontaine noch 1990 über Gysi und die PDS (Quelle: Politiker schimpfen über Politiker, Reclam1998)
Ich frage mich, wie lange die Erbschleicher des Stalinismus, die Herren Gysi, Kohl und Lambsdorff, noch warten wollen, bis sie das unrechtmäßig erworbene Parteivermögen auf Heller und Pfennig an das Volk zurückgeben.
- Seite zu Populismus in der Linkspartei
Spieglein, Spieglein in der Hand ...
Der Spiegel ist eines der wichtigsten Organe in der aktiven Beeinflussung gesellschaftlicher Diskurse, d.h. die Zeitung berichtet nicht über das Geschehen, sondern die Berichte schaffen sog. Wirklichkeit. Dabei verfolgen Spiegel-RedakteurInnen eigene politische Ziele, die meist wenig mit Aufklärung, aber viel mit Diskurssteuerung bis Manipulation zu tun haben. Dennoch seien hier Zitate über Lafontaine aufgeführt - aber mit dem warnenden Hinweis, dass diese in interessierter Ecke gesammelt werden.Bezeichnung für Gysi und Lafontaine im Spiegel 39/2005 (S. 66)
Linkenbändiger
Aus "Es geht nur um ihn" von Markus Deggerich und Gunther Latsch, in: Spiegel 37/2005 (S. 48)
Ein Volkstribun für soziale Gerechtigkeit ist er, der nur das große Ganze im Auge hat: den historischen Um- und Aufbruch, die "europaweite Bewegung", die "Idee, deren Zeit gekommen ist" - die "neue Linke". Klar, dass es nicht im Dunstkreis der Plattenbauten von Marzahn oder Hoyerswerda gewesen sein kann, wo Lafontaine erkannt haben will, dass der Wind der Geschichte sich dreht. Es war "in Paris", wie er seine Zuhörer mit pathetischem Tremolo in der Stimme wissen lässt, "auf der Place de la Bastille, jenem berühmten Platz der Französischen Revolution". Dort nämlich hat Oskar, mit "französischen Freunden", am Abend des Referendums die Ablehnung der Europäischen Verfassung gefeiert und "gespürt", dass "das Volk die Dinge wieder selbst in die Hand genommen hat". Dass ein Mann mit so viel Gespür, angesichts der historischen Tragweite der neuen Entwicklung, der Bewegung einzig als Lokomotivführer und nicht etwa als Heizer dienen kann, bekommt vor allem Gysi immer wieder zu spüren.


