POLIZEIZEUGEN: ZUR UNGLEICHBEHANDLUNG VON POLIZEI UND NICHT-POLIZEI VOR GERICHTEN
Justiz schützt Polizei
Justiz schützt Polizei ● Cops als Belastungszeug*innen ● Polizist*in als BeschuldigteR ● Falsche Beschuldigungen ● Polizeigewalt ● Polizei ist mehr wert ● Sonderthemen ● Links ● Warum entstand diese Aktion?
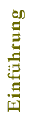 Der ehemalige Hamburger Innensenator Harthmut Wrocklage am 12.12.2006 in Marburg
Der ehemalige Hamburger Innensenator Harthmut Wrocklage am 12.12.2006 in Marburg
Die Polizei hat die Herrschaft über die Definition von Wirklichkeit.
Rechtskommentar des NS-Juristen Dr. Best, zitiert in Harnischmacher, Robert: „Die Polizei im NS-Staat“, Kriminalistik 7/2006 (S. 469) ++ Erklärung von Angeklagten
„Die Polizei handelt nie rechtlos oder rechtswidrig, soweit sie nach den von den Vorgesetzten – bis zur Obersten Führung – gesetzten Regeln handelt. ... Solange die Polizei diesen Willen der Führung vollzieht, handelt sie rechtmäßig.“
Zeugis in Uniform wird fast immer geglaubt. Sprechen sich mehrere Cops ab, gilt deren Aussage als besonders glaubwürdig, weil sie übereinstimmen. Treten Widersprüche auf, dann sind diese der Beleg für die besondere Glaubwürdigkeit. Absurd.
Wenn die Zeugis keine Polizistis sind, ist es plötzlich klar: "Zeugenaussagen sind ein häufiges, aber naturgemäß schwieriges Beweismittel. Erinnerungen trügen oder verblassen, ohne Absicht können Lücken mit Vermutungen geschlossen und als Fakt abgespeichert werden." (Gießener Allgemeine, 11.5.2024)
- Bericht "Polizist freigesprochen, der Beschuldigtem Gras unter geschoben hat" mit Darstellung wirrer Begründungen der Justiz, warum Uniformierte das Recht brechen dürften, auf: LTO am 6.1.2025
Um 2005 entstand eine umfangreiche Datensammlung zur systematischen Ungleichbehandlung von PolizistInnen und Nicht-Polizeiangehörigen vor deutschen Gerichten entstehen. Anlass war eine Verfassungsbeschwerde gegen die Weigerung eines Gießener Gerichts und des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes, eine Festnahme gerichtlich zu überprüfen (Az. beim BVerfG: 2 BvR 537/06). Der Aufruf dazu (befand sich auch als Wiki):
Im Original: Texte zur Bevorzugung von Polizeizeugen ...
Aus einem Text des Anwaltes Rolf Gössner in: Ossietzky 15/2003
So tragisch solche Vorfälle sind – es kommt noch ein gravierendes Problem hinzu: das der mangelhaften Aufarbeitung von Todesschüssen, aber auch von Polizeiübergriffen und unverhältnismäßigen Polizeieinsätzen. Die Aufklärungspraxis verläuft in aller Regel schleppend, was letztlich zu einer relativen Sanktionsimmunität von mutmaßlichen Polizeitätern und ihren Dienstvorgesetzten führt. Woran liegt das? Einige der möglichen strukturellen Probleme und Hindernisse bei der Aufklärung sollen im folgenden kurz benannt werden:
- Spezielle Dienstbetreuung: Die meisten Polizeilichen Todesschützen, so die Erfahrung, erleiden nach ihrer Tat einen Schock und sind mitunter wochenlang vernehmungsunfähig. Für sie gelten – gestützt auf die „Fürsorgepflicht“ ihres Dienstherrn – gewisse Sonderrechte: Sie werden von der Außenwelt abgeschottet und erhalten regelmäßig eine spezielle dienstliche und polizeipsychologische „Betreuung“, bevor sie verantwortlich vernommen werden – wohingegen „normale“ Bürger, die in eine tödliche Schießerei verwickelt waren, auf der Stelle verhört werden, oft stundenlang, und in Untersuchungshaft wandern. Selbstverständlich kämpft jeder Polizist, der ein Menschenleben auf dem Gewissen hat, mit schweren Schuldgefühlen, unabhängig davon, ob er formal im Recht war oder nicht. Der tödliche Schuss ist „wie ein Urknall, da entsteht eine neue Welt, die Außenstehende oft nicht begreifen“, weiß Polizeipfarrer Martin Krolzig, der schon viele Todesschützen betreut hat. Fast immer werde der Schuss zum Knick in der Laufbahn.
Doch unabhängig davon, dass solche persönlichen Probleme angemessen aufgearbeitet werden müssen, birgt die dienstliche „Betreuung“ oder „persönliche Nachbereitung“ durch Führungsbeamte etliche Gefahren, die bis zur Manipulation der Ermittlungen führen können, ja bis zur dienstlichen Beeinflussung von Polizeizeugen.- Mangelnde Unabhängigkeit: Eine falsch verstandene „Fürsorgepflicht“ der Polizeiführungen gegenüber ihren Polizeibeamten schlägt nicht selten durch bis zur Staatsanwaltschaft. Die Ankläger haben sich insoweit nur selten als Korrektiv erwiesen. Da die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft – als deren „Hilfsbeamte“ sie dann tätig wird – auch die Ermittlungen in eigener Sache führt, wird sie also Ermittlungsinstanz gegen sich selbst – eine in einem demokratischen Rechtsstaat unerträgliche Situation. Die funktionell dem „Staatswohl“ dienenden Staatsanwälte tun sich traditionell schwer damit, gegen in Verdacht geratene „Staatsdiener“ im Polizeidienst mit der gleichen Intensität zu ermitteln, wie sie das gegen Privatpersonen zu tun pflegen. Schließlich ist die Staatsanwaltschaft im Rahmen der Strafverfolgung auf ihre polizeilichen „Hilfsbeamten“ und deren Loyalität angewiesen – eine objektive Nähe, die die Ermittlungen als Kontrolle im eigenen Lager und damit als nicht wirklich unabhängig erscheinen lässt. In diesem Verfahrensabschnitt bleiben denn auch viele der Ermittlungsverfahren hängen.
- Exekutive Steuerung: Der Polizei als einerseits durch Schusswaffengebrauch beteiligter Partei sowie als später ermittelnder Behörde andererseits fällt in gewisser Weise die Definitionsmacht über die jeweilige Situation vor Ort zu, etwa was die Frage Bedrohungssituation, Notwehr oder Putativnotwehr betrifft. Vielfach wird der Polizei die Vernehmung der eigenen beschuldigten Kollegen übertragen; gelegentlich unterbleiben ansonsten übliche Ermittlungs maßnahmen und Beweismittel werden unterdrückt. Die Polizeiführungen haben Einfluss darauf, ob und was Polizeizeugen vor Gericht aussagen dürfen, wann etwa beamtete Zeugen gesperrt oder mit eingeschränkten Aussagegenehmigungen ausgestattet wer den, falls es um polizeistrategische oder –taktische Angelegenheiten geht, die aus Gründen des „Staatswohls“ geheimgehalten werden müssen. Diese exekutiven Steuerungsmöglichkeiten und selektiven Ermittlungen haben entscheidenden Einfluss auf die späteren Beweiserhebungen und Sachverhaltsfeststellungen der befassten Gerichte.
- Exekutiver Amtsbonus: Kommt es trotz dieser Negativ-Faktoren doch zu einer Anklage und zu einer Hauptverhandlung gegen beschuldigte Polizeibeamte, dann haben sie häufig auch vor Gericht einen relativ guten Stand. Denn manche Strafrichter haben die exekutive Position immer noch so stark verinnerlicht, dass sie bereit sind, den Polizeiführungen und den einzelnen beschuldigten Polizisten vieles nachzusehen und beamteten Zeugen mehr zu glauben als Privatpersonen. So triumphiert die parteiliche Polizeiversion über tödlich verlaufene Fahndungen, Verkehrs- und Identitätskontrollen oder Festnahmen mitunter qua exekutivem Amtsbonus über die historische Wirklichkeit – und wird so zur Basis eines Gerichtsurteils, das dem „Wohle“ des Staates dient, der sich auf diese Weise der Bevölkerung gegenüber zu entlasten weiß. So mancher Richter wird so zum Rechtfertigungsgehilfen im Sinne der „Staatsräson“, das Strafurteil zur nachträglichen Legitimierung tödlich verlaufener Polizeipraktiken und mitverantwortlicher apparativer Strukturen. Doch es gibt immer wieder rühmliche Ausnahmen von diesem Grundmuster.
- Rechtfertigungsmuster: Die meisten der eingeleiteten Ermittlungsverfahren werden letztlich eingestellt, enden mit einem Freispruch, mit einer Geld- oder geringen Bewährungsstrafe – entweder, weil der beschuldigte Beamte nach Polizeirecht oder den Dienstvorschriften schießen durfte oder weil der Todesschütze in Nothilfe oder Notwehr gehandelt habe, etwa weil ihn das Todesopfer, das er nur kampfunfähig schießen wollte, zuvor bedroht habe. Das sind sogenannte Rechtfertigungsgründe, die Polizeibeamten als Träger hoheitlicher Gewalt ebenso wie ganz normalen Bürgern selbstverständlich, aber zuweilen recht unhinterfragt zugestanden werden.
Auch wenn tatsächlich keine Notwehrsituation erkennbar ist, dann mag der Polizeischütze zumindest Umstände angekommen haben, die eine tödliche „Notwehrhandlung“ entschuldigen, obwohl tatsächlich keine objektive Gefahr bestanden hatte. Das nennt sich dann „vermeintliche“ oder Putativ-Notwehr: Zum Beispiel habe das Opfer eine „verdächtige“ Bewegung gemacht, obwohl es tatsächlich unbewaffnet war – wie etwa jener Mann, der wegen eines Verkehrsverstoßes vor der Polizei geflüchtet war. Als ihn einer der Polizisten mit gezogener Pistole stellte und „Hände hoch“ rief, nahm er die Hände aus der Hosentasche. Der Beamte fühlte sich bedroht, schoss und traf den Verkehrssünder tödlich.- „Organisierte Verantwortungslosigkeit“: Obwohl das Problem polizeilichen Schusswaffengebrauchs mit Todesfolge nicht allein ein individuelles, allein in der Person des Schützen liegendes Problem ist, bleiben die strukturellen und mentalen Ursachen und Bedingungen bei der justiziellen Aufarbeitung allzu oft unberücksichtigt – zumal sich das individualisierende Strafverfahren kaum eignet, die bürokratischen Strukturen, antrainierten Handlungsmuster (etwa im Zusammenhang mit der „Eigensicherung“) und ideologischen Konstrukte (etwa „Feindbilder“), um die es eben auch geht, zu erfassen und mitverantwortlich zu machen für das polizeiliche Verhalten. Die eigentlich verantwortlichen (Führungs-) Personen und mitursächlichen Strukturen bleiben also ungeschoren. Auf diese Weise können sich Polizei und Bedienstete gelegentlich „hinter einer organisierten Verantwortungslosigkeit und dem Schutzschild der Amtsautorität zurückziehen“, wie es der Polizeiforscher Falko Werkentin schon früher formulierte.
So berücksichtigten Gerichte etwa zugunsten des Angeklagten strafmildernd, dass er „im Rahmen der Fortbildungslehrveranstaltungen eine zum Schusswaffengebrauch eher ermunternde als Zurückhaltung empfehlende Ausbildung erhalten“ habe, für die er nicht verantwortlich sei; oder in einem anderen Fall, dass es an der erforderlichen Schießausbildung gefehlt habe. Im übrigen sollen durch die strafrechtliche Ahndung „Einsatzfreude“ und „Risikobereitschaft“ der Polizeibeamten – und damit die „Funktionstüchtigkeit“ der Polizei – nicht beeinträchtigt werden.
Eine wirklich unabhängige Kontrolle in diesem Bereich polizeilich-finalen Handelns, aber auch im Fall von Polizeiübergriffen, findet eher selten statt. Um den genannten strukturellen Kontrollhindernissen wenigstens ansatzweise entgegenwirken zu können, ist eine kritische Öffentlichkeit unabdingbar – damit Ermittlungsverfahren gegen beschuldigte Polizeibeamte nicht gleich im Vorfeld sang- und klanglos eingestellt werden. Denn erst in einem öffentlichen Prozess kann die offizielle Polizeiversion – insbesondere durch Nebenkläger und Medien – kritisch hinterfragt, sollten auch die strukturellen Hintergründe der Tat thematisiert werden. Das ist auch zur Aufklärung der Todesschüsse von Heldrungen und Nordhausen mit Nachdruck zu fordern.
Aus Kreickenbaum, Martin, "Die Polizei schlägt und der Staat schaut weg" (Quelle hier ...)
Polizeiliche Todesschützen, aber auch andere mutmaßliche Polizeitäter dürfen sich nicht länger hinter dem Schutzschild der Amtsautorität verschanzen, ihnen dürfen im Ermittlungsverfahren nicht länger aus “Fürsorgepflicht” Sonderrechte eingeräumt werden, sie dürfen nicht schonender behandelt werden, als andere mutmaßliche Straftäter. Und es ist nicht hinnehmbar, dass die Exekutive prägenden Einfluss auf die Ermittlungen – in denen die Polizei oft in eigener Sache tätig wird – und auf die anschließenden Strafverfahren nimmt, wie sie es in Thüringen wiederholt versucht hat. Sonst triumphiert wieder die Polizeiversion.
Selbst die UN hat durch ihren Menschenrechtsausschuss und den Ausschuss gegen Folter mehrfach ihre Besorgnis ausgedrückt über Misshandlungen durch die deutsche Polizei und die geringe Quote von Strafverfolgungen und Verurteilungen bei behaupteten Fällen polizeilicher Misshandlungen. Aber die Polizei beweist nicht nur bei den Gewalttaten, sondern auch in ihrer Reaktion auf die erhobenen Vorwürfe "eine erschreckende Kontinuität", wie amnesty bemerkte.
Misshandlungen werden von der Polizei als "bedauerliche Einzelfälle" abgetan, die von "wenigen schwarzen Schafen, die es überall gibt" zu verantworten seien. Sie weist die von amnesty und Aktion Courage vorgelegten Berichte als Diffamierungen und populistische Hetze zurück. Den beiden Menschenrechtsorganisationen wird dabei vorgeworfen, Gerichtsurteile zu ignorieren und rechtsstaatliche Mittel nicht zu akzeptieren. Dabei zeigen die Studien vor allem, dass der Staat gerne wegschaut, wenn Polizisten wehrlose Menschen misshandeln.
Konrad Freiberg, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, geht gegenüber der Süddeutschen Zeitung dabei so weit, die Opfer selbst zu diffamieren, denn die Anzeigen "werden erstattet von Betrunkenen, geistig Verwirrten, von Menschen, die im Konflikt mit der Polizei in Hitze geraten sind, oft auch von festgenommenen Asylbewerbern, aber auch von Tätern aus der organisierten Kriminalität". Und diese dürfen, soll das wohl heißen, von der Polizei misshandelt werden.
In das gleiche Horn stieß der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Wolfgang Arenhövel. Er wies nicht nur jeden Vorwurf der Kumpanei zwischen Polizei und Justiz zurück, sondern behauptete, dass es bei vorläufigen Festnahmen schon mal zu "Rangeleien" kommt, die von den Betroffenen nur falsch interpretiert würden.
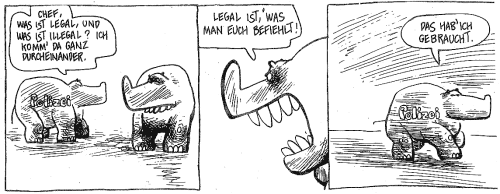
- Gegenüberstellung: Verfahren gegen PolizeibeamtInnen und DemonstrantInnen (G8-Gipfel Genua 2001) ++ Urteile Polizei
Ein Polizist packt aus - dokumentiert in der taz vom 21.11.2008:
"Der Prozess fand in Bonn statt. Die Anklage lautete auf Beleidigung. Der Zuschauerraum war voll mit Polizisten. Wir waren vier Zeugen. Ich, der Azubi, war der Hauptzeuge. Mir ging ein bisschen die Muffe, weil ich gehört hatte, dass der Ströbele der Verteidiger von Frau Gottwald ist. ,Bei dem müssen Sie aufpassen. Der hat die Baader-Meinhof-Geschichte mit vertreten', hatte mich mein Hundertschaftsführer gewarnt. Aber für den Staatsanwalt und das Gericht war der Fall von Anfang an klar. Ihre Antipathie gegen Frau Gottwald und Herrn Ströbele war deutlich zu spüren. Wenn man dann noch die Kollegen im Publikum flüstern hört: ,Gib Gas!', ,Mach weiter!', wird man, so jung wie ich war, als Zeuge richtig keck. Es war ein abgekartetes Spiel, obwohl der Ströbele sehr eloquent war. Wir vier Zeugen waren uns einig. Frau Gottwald hatte keine Chance. Auch die Berufungsverhandlung endete mit einer Verurteilung. Der Polizei als Staatsgewalt wird grundsätzlich geglaubt. Ein Polizist, so die gängige Auffassung, lügt nicht. Schließlich ist er auf das Grundgesetz vereidigt. Zum Zeitpunkt des Berufungsprozesses hatte ich eigentlich die Schnauze voll. Aber wenn man einmal eine Falschaussage gemacht hat, kommt man nicht mehr raus - zumal, wenn vier Leute drinhängen. ... Ich habe noch Verbindung zur Polizei und höre, dass nach wie vor gemauschelt wird. Man kann im Einsatz immer so oder so entscheiden. Man braucht nur eine einfache Verkehrskontrolle anzugucken. Bürgern, die frech Paroli bieten oder politisch unliebsam sind, wischt man gern mal eins aus. Was ins Beuteschema passt, wird ausgenutzt. Ich war dabei, wie ein Obdachloser, der Kinder angebaggert hat, auf der Wache getreten worden ist. Immer in den Arsch. Selbst da hatte ich das Gefühl, dass hat er verdient. Wieso packt der Kinder an? Wir haben Obdachlose - Penner, wie wir sagten - mit dem Streifenwagen 30 Kilometer außerhalb der Stadt bei Wind und Wetter ausgesetzt. Warum ich das alles nach 25 Jahren offenbare? Ich bin selbst Opfer eines Lügenkomplotts geworden. Es ist eine extrem demütigende Erfahrung. Ich schäme mich, dass ich mich an so etwas beteiligt habe. Ist doch klar, wem der Richter glaubt, wenn Aussage gegen Aussage steht. Die Polizei hat die Macht."
Aus Manfred Such (1988): "Bürger statt Bullen", Klartext in Essen (vergriffen)
Zu Falschaussagen und Manipulationen seitens der Polizei (S. 9):
Ich höre heute noch einen Richter auf einem Fortbildungsseminar für Polizeibeamte sagen, daß er sich nicht vor stellen könne, daß Polizeibeamte vorsätzlich falsche, Angaben machen könnten; um eine Person der Verurteilung, zu zuführen. Vor so viel Blauäugigkeit herrschte im Zuhörerkreis der Polizeibeamten nur betretenes, schamhaftes Schweigen. Niemand erklärte dem Richter, daß es das gibt. Auch ich nicht! Von Parlamenten und Politikern eine Kontrolle zu erwarten, habe ich lange aufgeben, denn von Teilen der Politik wird die Polizei zur Durchsetzung politischer Ziele mißbraucht.
Aus "Zweierlei Maß", in: Junge Welt, 23.12.2008 (S. 4)
Pro Jahr werden in Hamburg etwa gegen 300 Polizeibeamte Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt eingeleitet – vor Gericht verantworten mußte sich allerdings in den letzten drei Jahren nur ein einziger. Die Staatsanwaltschaft entscheidet fast immer zugunsten der Beamten und stellt die Verfahren ein.
Aus "Weil wir es können ..." über Polizeilügen, in: telepolis 13.2.2013
Die Polizei kann sich dabei stets auch auf Richter verlassen, die Polizisten mehr glauben als dem "Normalmenschen", die also davon ausgehen, dass Aussagen von Polizisten per se glaubwürdig sind. Dabei haben etliche Fälle bereits gezeigt, dass diese Ansicht nicht stimmen kann. ...
Auch in Deutschland zählt die Aussage eines Polizisten im allgemeinen stärker als die Aussage der beschuldigten Person Der Polizist wird als integer, glaubwürdig und vor allen Dingen auch als der Wahrheit verpflichtet wahrgenommen, und es wird ausgeblendet, dass Fälle von Polizeigewalt, falschem Corpsgeist und Falschaussagen dieser Annahme bereits entgegenstehen. Dabei reicht die Bereitschaft zu lügen bis in die obersten Etagen und bis zum Bundeskriminalamt und Co. ...
Ob Polizeigewalt oder Falschaussagen – gerade auch die Innenminister bzw. die obersten Chefs z.B. des BKA und die Polizeigewerkschaften sind es, die für mehr Respekt gegenüber der Polizei trommeln, die den abnehmenden Respekt und die beschädigte Reputation der Polizei wehklagend kommentieren und doch selbst bei Fällen wie dem der "mg" mit all seiner Brisanz schlagartig verstummen, wenn es um Fehlverhalten der Strafverfolgung selbst geht. Gebetsmühlenartig wird auf bedauerliche Einzelfälle verwiesen, auf den Stress, dem die Strafverfolgung ausgesetzt ist, und auf die fehlende Bereitschaft der Bevölkerung, dies anzuerkennen, als sei Stress tatsächlich eine Begründung oder gar Entschuldigung für ein nicht rechtstaatlich akzeptables Verhalten seitens derer, die immerhin das Gewaltmonopol innehaben und durch ihre Falschaussagen oder ihr Fehlverhalten Existenzen in kürzester Zeit vernichten können.
Es ist genau dieses Verhalten seitens der "Oberen", was letztendlich dazu führt, dass die Polizei weiterhin auch gerade für gewaltbereite Schlägertypen, Sozio- und Psychopathen sowie karrierebegeisterte Duckmäuser attraktiv ist. Genau dieses Verhalten ermöglicht es, weiterhin den Corpsgeist hochzuhalten und innerhalb der Strafverfolgung verschworene Gemeinschaften zu bilden, die dann auch vor Falschaussagen und all ihren Folge nicht zurückschrecken. Die durchaus berechtigte Annahme, dass das Fehlverhalten durch die Verantwortlichen nicht nur gedeckt, sondern ggf. auch gutgeheißen wird, hat letztendlich zur Folge, dass sich dieses Verhalten ausbreitet und zur Norm wird.
Im Original: Polizeijammern ...
Franziska Coesfeld, "Hamburger Kriminologe: Die Polizei jammert zu viel", in: Hamburger Abendblatt 24.08.201
Kriminologe schaltet sich in Debatte um Respektlosigkeit ein. Er attackiert die Gewerkschaften und fordert eine bessere Ausbildung.
Hamburger Polizisten begleiten eine Demonstration. Viele Beamte klagen, dass sie auch bei solchen Einsätzen respektlos behandelt werden.
Hamburg. Hamburgs Polizeibeamte müssen ständig als Prellbock herhalten - zumindest wird das von ihren Gewerkschaften regelmäßig angeprangert. Rafael Behr, seit 2008 Professor für Polizeiwissenschaften an der Hochschule der Polizei, lässt das nicht gelten. "Dafür sind die Beamten schließlich auch da. Als Vertreter des Gewaltmonopols muss ich damit rechnen, dass ich selbst beschädigt werde." Alles andere sei Realitätsflucht.
"Die Polizei jammert zu viel." Damit reagiert der Kriminologe auf die aktuelle Diskussion über Respektlosigkeit gegenüber Beamten. Die Gewalt gegen Polizisten hat stark zugenommen - das ist die Einschätzung, mit der Innensenator Michael Neumann (SPD) und Gewerkschaften in den vergangenen Wochen an die Öffentlichkeit gegangen sind. Behr widerspricht dieser Aussage vehement. "Das ist falsch", sagt der 53-Jährige. Zugenommen hätten lediglich die subjektive Wahrnehmung, dass die Gewalt steige, und die Situationen, die die Schutzleute als gewalttätig wahrnehmen. "Aber die Anzahl der gravierenden Verletzungen, die nehmen radikal ab." Das belege auch eine Studie Christian Pfeiffers, der dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen vorsteht.
Das Jammern habe bei der Polizei eine "gewisse Tradition". "Die Parole der Hauptjammerer, der Gewerkschaften und der Personalräte, lautet: Es wird immer alles schlimmer, mehr und unkontrollierbarer", sagt Behr. Kollektiv gestöhnt wird mit klarem Ziel: Aufmerksamkeit zu erzeugen, Rückhalt in der Öffentlichkeit und finanzielle Ressourcen bei der Politik zu sichern.
"Dass sich die Polizei als Opfer darstellt, ist unprofessionell", sagt Rafael Behr. Die Gesellschaft wolle von der Polizei beschützt werden. "Wenn sich die Beschützer jedoch als Opfer, als Spielmaterial für Randalierer definieren, entstehen Irritationen in der Bevölkerung." Dieses Rollenverständnis hält er für fatal. "Die Polizei ist schließlich kein passives Opfer, sondern muss aktiv werden, wenn sie sich ohnmächtig fühlt."
Professor Behr ist keineswegs Theoretiker. Er war selbst 15 Jahre lang Polizist, ist Streife gefahren und kann sich an Großeinsätze wie Demonstrationen gegen die Startbahn West am Frankfurter Flughafen und gegen diverse Kernkraftanlagen erinnern. Ein großes Problem sieht Behr darin, dass jungen Beamten von Kollegen von Anfang an eingetrichtert werde, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Die Folge: Schon die Berufsanfänger entwickeln Strategien, die im Fachjargon unter dem Begriff "defensive Solidarität" zusammengefasst werden. Der Polizist stuft die Umgebung von vornherein als feindlich ein. Er kapselt sich ab, traut nur noch seinen Kollegen, unterscheidet strikt zwischen "wir", die Polizisten, und "sie" - also alle anderen.
"Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Schutzmann in Konfliktsituationen dann härter reagiert, als er müsste", sagt Behr. Die Konsequenz: Der Bürger nimmt den Beamten als unverhältnismäßig ruppig wahr. Es entstehe ein Spirale, die sich immer weiter nach oben schraube, die Misstrauen zwischen Beamten und Bürgern schüre.
Dabei werde die Institution Polizei von der Öffentlichkeit laut Behr hoch geschätzt. "Der einzelne Beamte übernimmt diese Wertschätzung jedoch nicht." Er traut der positiven Bewertung nicht, weil seine individuellen Erfahrungen häufig nichts mit Achtung und Respekt vor der Polizei zu tun haben. Beamte fühlen sich oft nicht ernst genommen, verspottet, attackiert. "Vor allem in sozialen Brennpunkten empfinden sie sich wie Underdogs", sagt der Polizeiexperte.
Zwar nimmt Behr das Klagen der Beamten sehr ernst, dass sie sich in bestimmten Situationen ohnmächtig fühlten. "Aber Fakt ist, dass die Gewalt gegenüber Polizisten nicht zugenommen hat." Entscheidend sei, wie die Verletzungen gezählt und klassifiziert werden. "Wer sich beim Sanitäter meldet, wird als verletzt registriert", sagt Behr. Doch nicht immer ist die Verletzung auf einen Angriff eines Randalierers zurückzuführen. Behr nennt ein Beispiel: "Die Polizei setzt bei einem Einsatz Tränengas ein. Der Wind dreht, 50 Beamte werden verletzt und müssen behandelt werden. Diese Fälle fließen ebenfalls in die Statistik mit ein." Und verfälschen die Erhebung folglich.
In der Debatte um zunehmende Respektlosigkeit spielten zudem Ort und Zeit eine wichtige Rolle. "Anders als etwa in Bramfeld dürfen die Beamten nachts auf der Reeperbahn keinen Respekt erwarten", sagt Behr. "Zu denken, dem Schutzmann wird dort auf dem Bürgersteig der Weg frei gemacht, ist naiv." Auf dem Kiez herrsche schließlich keine Dorfidylle. "Die Polizisten, die schlau sind, schützen sich anders", sagt Behr und schiebt gleich eine Forderung hinterher: Gerade jungen Beamten muss das Handwerkszeug vermittelt werden, wie sie professionell mit Respektlosigkeit umgehen.
An entsprechenden Ideen mangelt es Behr nicht. Seine Vorschläge: Nicht die Polizisten müssen für Lehrgänge zur Schule, sondern der Lehrer muss zu den Beamten. Und zwar zunächst als Fragender und nicht als Wissender. Vor Ort kann der Trainer wichtige Fragen mit den Kollegen klären: Was können wir in diesem Kommissariat dafür tun, dass sich die Polizisten weniger respektlos behandelt fühlen? Mit welchen besonderen Belastungen fühlen sich diese Polizisten täglich konfrontiert? Was können sie an ihrem Veralten hier in der Wache ändern? Anschließend können Situationen im Alltag erprobt und gemeinsam reflektiert werden. "Das wäre ein Paradigmenwechsel." Behr weiß, dass er mit seinen Vorschlägen und Thesen aneckt. Thesen wie: Die Polizei sei beim Thema "Gewalt gegen Beamte" auf dem falschen Weg. Behr geht noch weiter. "Es ist dringend nötig, Polizei neu zu denken. Und zwar radikal." Denkbar sei ein regelmäßiges Coaching für Polizisten, um etwa mit dem Thema Respektlosigkeit besser umgehen zu können. Und auch von einem Rotationssystem innerhalb der Polizei verspricht er sich Gewinn: Vor allem Beamte, die in einem prekären Handlungsfeld tätig sind, müssen "regelmäßig ihre Tretmühle verlassen" und in einem ruhigeren Bereich arbeiten. Das biete die Gelegenheit, die eigene Rolle zu reflektieren.
Zudem hält Rafael Behr es für wichtig, Polizisten schon in der Ausbildung Selbstbewusstsein zu vermitteln. Auch er musste als Polizist viel einstecken. Sich Beleidigungen wie "Scheißbulle" und "verpiss dich" anhören. Er wurde bepöbelt. Geschubst. Angespuckt. "Es war nicht so viel anders als heute." Wichtig sei, schwierige Situationen wie diese als Herausforderung zu sehen - und nicht als Strafe. "Das ist der Job eines Polizisten."


